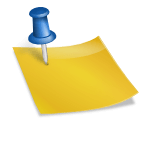Von Ralf Keuper
Die Stadtforschung hat den letzten Jahren einige bemerkenswerte Ideen hervorgebracht, wie sich das Zusammenleben in den urbanen Zentren am besten gestalten lässt. Sie reichen von dem umstrittenen Konzept der Charter Cities von Paul Romer über den Klassiker der Kreativstädte nach Richard Florida bis zur Arrival City von Doug Saunders und den Arbeiten der Anthropologin Janice Perlman über Favelas.
Insbesondere die beiden letzten Ansätze halte ich für nachdenkenswert.
Für Saunders erfüllen Ankunftsstädte eine wichtige soziale Funktion, deren Wert von den heutigen Stadtplanern und Kommunalpolitikern der Mega-Städte nicht in ausreichendem Maß erkannt werde. Aber auch die arrivierten Bewohner der Metropolen verschließen ihre Augen vor deren Nutzen:
Die Menschen erkennen die Funktion nicht, die Ankunftsstädte erfüllen, und verdammen sie deshalb wegen ihrer Armut und ihres provisorischen Erscheinungsbilds als dauerhafte und nicht sanierungsfähige Slums. Es stimmt zwar, dass viele Ankunftsstädte als Slums beginnen, aber nicht alle Ankunftsstädte sind Slums. .. Ankunftsstädte können in Verzweiflung und Armut abrutschen, wenn nach einer oder zwei Generationen der Weg zur Ankunft dauerhaft blockiert wird. … In den Ankunftsstädten leben auch nicht nur Arme. Diese Enklaven werden, wenn sich die Lebensverhältnisse dort verbessern und eine eigene, aus den Reihen der Migranten kommende Mittelschicht entsteht, zu Magneten für Menschen, die aus der überbevölkerten Innenstadt wegziehen, und entwickeln neue wohlhabende Mittelschichten. Viele der inzwischen attraktivsten Wohnbezirke in New York, London, Paris und Toronto entstanden einst als Ankunftsstädte, und inzwischen gibt es auch in Rio de Janeiro und anderen gefragten Hauptstädten in den Entwicklungsländern Ankunftsstädte, die in jeder Hinsicht von der Mittelschicht geprägt werden.
In einem Interview mit Laura Weissmüller in der SZ vom 10. Januar 2014 äußerte sich die Anthropologin Janice Perlman, die seit Jahrzehnten über die brasilianischen Favelas forscht, über den Nutzen der informellen Siedlungen für die Mega-Städte:
Sie sagen, Städte können es sich gar nicht leisten, jemanden auszuschließen
Es gibt keinen Weg, eine nachhaltige Stadt zu sein, ohne eine Stadt für alle zu sein. Denn wenn man informelle Siedlungen ausschließt aus der Stadt – und damit bis zu 70 Prozent der Bevölkerung – dann ist die Stadt politisch instabil. Sie kann nicht so viel konsumieren, sie kann nicht so viel produzieren. Und das Schlimmste: Die Stadt verpasst ihr Wissenskapital, die Kreativität, das Potenzial, das in Favelas lebt, aber nicht ausgeschöpft werden kann. .. Außerdem wäre die Stadt ohne einen informellen Bereich eine sehr langweilige Stadt. …
Wie sähe denn eine Welt ohne informelle Siedlungen aus?
Ich glaube, das würde all diesen Städten die Lebensfreude nehmen und auch das, was sie ausmacht. Rio etwa würde zur Kopie einer normalen, gewöhnlichen, langweiligen Stadt. Sie würde wie jede andere Stadt aussehen, mit den gleichen Straßen, der gleichen Musik, dem gleichen Essen. Es gäbe keine kreative Dynamik – aber erst die erzeugt Innovationen. Eine innovative Stadt muss eine heterogene Stadt sein. Das bieten nur unterschiedliche Wohnräume und Flächen, wo man anders sein kann.
Weitere Informationen:
Urbanisierung, Megastädte und informelle Siedlungen
Georg Simmel: Die Grosstädte und das Geistesleben