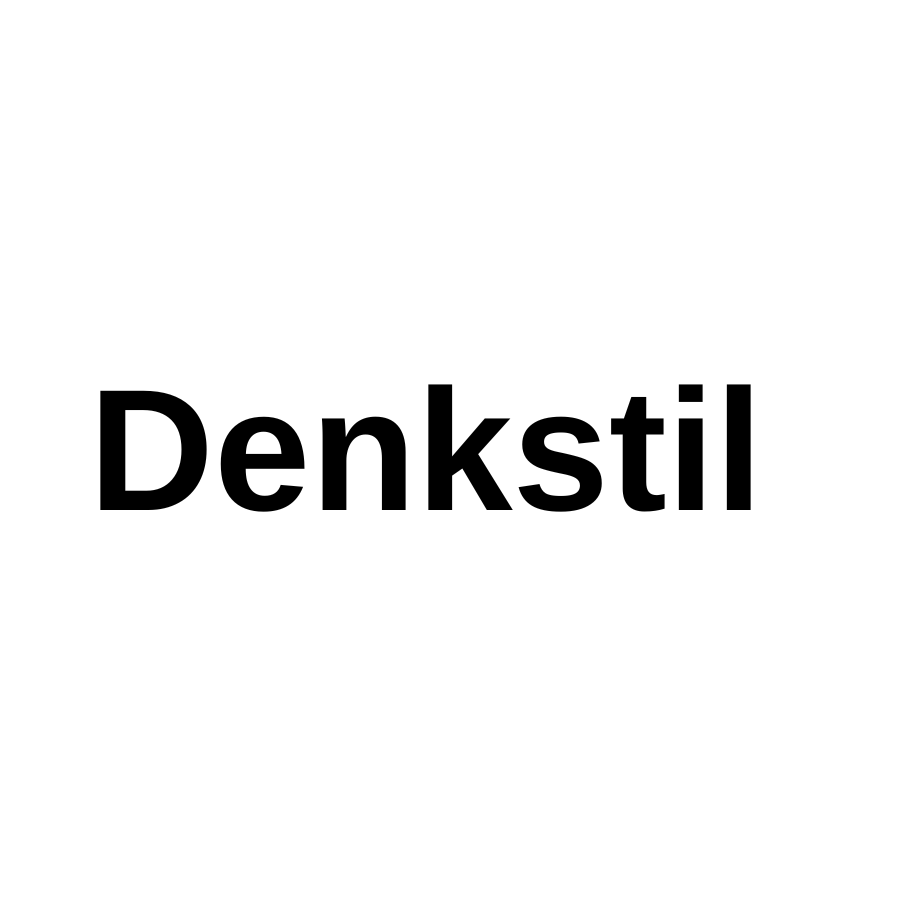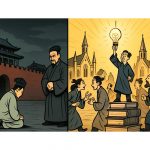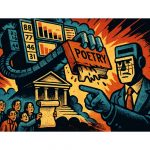Europa rüstet auf, spricht von Verteidigungsfähigkeit und strategischer Autonomie. Doch die Realität ist ernüchternd: Ohne chinesische Seltene Erden, ohne asiatische Halbleiter und ohne gesicherte Energieströme wäre der Kontinent binnen Wochen gelähmt. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Kriege nicht auf Schlachtfeldern, sondern in Fabriken entschieden werden – und dort steht Europa auf tönernen Füßen.
Der Zusammenbruch als Gewissheit
Ein großflächiger Krieg in Europa – ob durch Eskalation mit Russland oder einen Konflikt mit China – würde nicht zu wirtschaftlicher Mobilisierung führen, sondern zum industriellen Kollaps. Diese Einschätzung teilt die gesamte Fachwelt. Die geopolitischen Spannungen der Gegenwart belasten bereits jetzt die europäischen Volkswirtschaften massiv: Die deutsche Industrieproduktion brach im August 2025 um 4,3 Prozent ein, die Autoindustrie sogar um 18,5 Prozent. Ein tatsächlicher Krieg würde diese Entwicklung nicht umkehren, sondern radikal verschärfen.
Europa lebt von Exporten, internationaler Kooperation und hochkomplexen Lieferketten. Ein Krieg würde diese Grundlagen vernichten. Energieversorgung, Rohstoffzugänge und Absatzmärkte würden sofort wegbrechen. Das Beispiel Russlands zeigt empirisch, dass eine Umstellung auf Kriegswirtschaft kurzfristig Beschäftigung schafft, langfristig aber Ressourcen aus zivilen Sektoren abzieht und die Produktivität zerstört. Europa wäre aufgrund seiner extremen Importabhängigkeit bei Energie, Metallen und Elektronikkomponenten besonders verwundbar. Bereits die Ukrainekrise traf 75 Prozent der deutschen Industrieunternehmen durch gestörte Lieferketten, Cyberangriffe und Energieknappheit.
Ein großer Krieg würde globale Handelsrouten blockieren, Öl- und Gaspreise vervielfachen und das BIP der EU um bis zu 70 Milliarden US-Dollar pro Jahr senken. Für Volkswirtschaften wie Deutschland, die von industrieller Vernetzung leben, wäre das kein „Kriegsboom“, sondern der strukturelle Untergang.
Die chinesische Rohstoffhegemonie
Die zentrale Verwundbarkeit Europas liegt in seiner totalen Abhängigkeit von asiatischen Rohstoffen. China kontrolliert 92 Prozent der weltweiten Raffinierung seltener Erden, 87 Prozent der Graphit-Verarbeitung und über 70 Prozent der globalen Kobalt- und Galliumproduktion. Diese Materialien sind unverzichtbar für Rüstungsgüter, Batterien, Halbleiter und optische Systeme – also sämtliche Komponenten einer modernen Verteidigungsindustrie.
Die EU importiert 98 Prozent ihrer Magnete mit seltenen Erden aus China. Ohne diese könnten keine Elektromotoren, Präzisionswaffen oder Energiespeicher hergestellt werden. Selbst elementare Stoffe wie Antimon – in jeder modernen Munition enthalten – oder Baumwollzellulose für Nitrozellulose-Pulver stammen fast vollständig aus chinesischer oder südasiatischer Produktion. Seit 2024 hat Peking Exportlizenzen für viele dieser Materialien eingeführt und Lieferungen nach Europa gezielt eingeschränkt.
Der EU Critical Raw Materials Act von 2024 sollte Abhilfe schaffen und vorsehen, dass bis 2030 höchstens 65 Prozent eines kritischen Rohstoffs aus einem einzigen Land stammen. Doch praktisch existieren kaum Alternativen. Neue Partnerschaften mit Chile, Kanada oder afrikanischen Staaten befinden sich in frühen Projektphasen, während China seine Kontrolle durch Investitionen in Minen weltweit weiter ausbaut.
Die strategische Schlussfolgerung ist eindeutig: Ohne asiatische Rohstoffströme wäre Europa nicht einmal ansatzweise in der Lage, einen Krieg industriell zu führen oder seine Verteidigungs- und High-Tech-Produktionsketten aufrechtzuerhalten. Jede militärische Eskalation, die diesen Fluss unterbricht, würde die europäische Industrie binnen Wochen lahmlegen.
Die historische Lektion: Rathenau, Speer und die Grenzen der Organisation
Die Geschichte lehrt eine unbequeme Wahrheit: Rohstoffe entscheiden Kriege. Ohne gesicherte Ressourcen ist keine Kriegsführung möglich. Das Deutsche Reich erlebte diese Realität zweimal in katastrophaler Form.
Im Ersten Weltkrieg führte die britische Seeblockade zum Wegfall von 46 Prozent der deutschen Einfuhren. Walther Rathenau gründete 1914 die Kriegsrohstoffabteilung, eine staatlich-industrielle Zwangswirtschaft zur zentralen Erfassung und Verteilung strategischer Rohstoffe. Er führte Ersatzstoffe wie synthetischen Stickstoff ein und reorganisierte die gesamte Ressourcenverteilung. Trotz dieser beachtlichen organisatorischen Leistung konnte die strukturelle Knappheit nicht aufgehoben werden.
Die Wirtschaftsleistung sank bis 1918 drastisch, der Zusammenbruch war nur verzögert.
Im Zweiten Weltkrieg gelang Albert Speer ab 1942 als Rüstungsminister durch Rationalisierung, Standardisierung und die Einbindung der Industrie in ein System von Ausschüssen eine deutliche Produktivitätssteigerung. Das von ihm geschaffene industriell-bürokratische Netzwerk erreichte in kurzer Zeit erhebliche Produktionszuwächse. Doch sein Erfolg beruhte auf extremer Zwangsarbeit, Raubwirtschaft in besetzten Gebieten und der Ausbeutung letzter Reserven. Ab 1944 kollabierten Transport, Energieversorgung und Materialnachschub.
Paul Pleiger leitete parallel die Reichswerke „Hermann Göring“, die heimische Eisenerze ausbeuten sollten, um Importabhängigkeiten zu mindern. Auch diese Struktur wuchs parasitär auf Raub und Sklavenarbeit und erwies sich langfristig als ineffizient.
Die historische Bilanz ist eindeutig: Rathenau, Speer und Pleiger stehen für das deutsche Muster, industriell-technische Effizienz als Ersatz für strukturelle Ressourcenbasis einzusetzen. Beide Regime verlängerten dadurch ihre militärische Kampffähigkeit, schufen aber keine nachhaltige Autarkie. Die „Überlebensverlängerung“ war technisch faszinierend, politisch jedoch tragisch – sie ermöglichte keine Wende, sondern nur einen längeren Weg in die Katastrophe.
Die Illusion europäischer Autonomie
Die Annahme, Europa könne in absehbarer Zeit Kontrolle über Material, Transport und Energie erlangen, gilt in der strategischen Analyse als utopisch. Zwar deckt die EU mittlerweile fast 47 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen und hat sich von russischen Gas- und Ölimporten weitgehend gelöst, doch echte Energieunabhängigkeit bleibt illusionär.
Die EU importiert weiterhin große Mengen kritischer Materialien für Solar-, Wind- und Speichertechnologien – Lithium, Nickel und Seltene Erden – hauptsächlich aus China, Afrika oder Südamerika. Auch beim Wasserstoff, mit dem Brüssel Unabhängigkeit sichern will, existiert kein gemeinsames europäisches Netz, das Versorgungssicherheit garantieren könnte.
Die physische Integration Europas stockt: Leitungsnetze, Eisenbahnkorridore und Häfen sind nicht auf Krisenautarkie ausgelegt. Die maritime Logistik hängt stark an globalen Frachtrouten und Subunternehmern aus Asien. Eine Kontrolle über Transportflüsse im Krisenfall ist kaum realistisch.
Großbritannien verfolgt seit 2024 einen Clean Power Action Plan mit dem Ziel, bis 2030 Energieunabhängigkeit zu erreichen. Doch London bleibt aufgrund importabhängiger Industrien, der Dominanz asiatischer Komponentenmärkte und fehlender inländischer Rohstoffe verwundbar.
Die vergessene Lehre
Moderne Militärhistoriker betonen, dass Kriege seit dem 20. Jahrhundert „zweifach entschieden“ werden: auf dem Schlachtfeld und in der Fabrikhalle. Produktion, Energie und Transport sind dabei entscheidender als Truppenstärke. Das gilt heute umso mehr für Hochtechnologie-, Drohnen- oder Satellitenkriege, in denen seltene Erden, Halbleiter und Energieträger die „strategische Munition“ darstellen.
Während die USA mit dem Defense Production Act strategische Reserven und Lieferketten sichern, verlässt sich die EU weiter auf Marktmechanismen. Das wäre im Ernstfall fatal. Deutschland und Europa verfolgen militärische Ambitionen, sind aber durch Rohstoffmangel faktisch begrenzt.
Europa kann seine Energie- und Materialabhängigkeit bestenfalls reduzieren, aber nicht überwinden. Weder erneuerbare Energien noch strategische Partnerschaften ersetzen die globale Infrastruktur, von der Industrie, Militär und Handel abhängen. Kontrolle über Material, Transport und Energie bleibt im europäischen Kontext ein idealistisches Konzept – realpolitisch unerreichbar.
Fazit: Militärische Stärke ohne Fundament
Die Geschichte hat immer wieder bewiesen: Staaten ohne Rohstoff- und Energiebasis verlieren Kriege – unabhängig von Idealen, Technologie oder Bündnissen. Europa hat diese Lehre vergessen. Ohne strukturelle Rohstoffsicherung, industrielle Eigenfertigung und Energieautarkie bleibt jede Aufrüstungsrhetorik symbolisch.
Ein europäischer Krieg wäre gleichbedeutend mit dem Zusammenbruch der europäischen und insbesondere der deutschen Industrie. Er würde nicht nur Werke und Infrastruktur zerstören, sondern auch die wirtschaftliche Basis – Energie, Handel, Arbeitskräfte und Vertrauen – vernichten. Militärische Stärke beginnt bei der Kontrolle über Material, Transport und Energie. Europa besitzt diese Kontrolle nicht – und wird sie auf absehbare Zeit nicht erlangen.