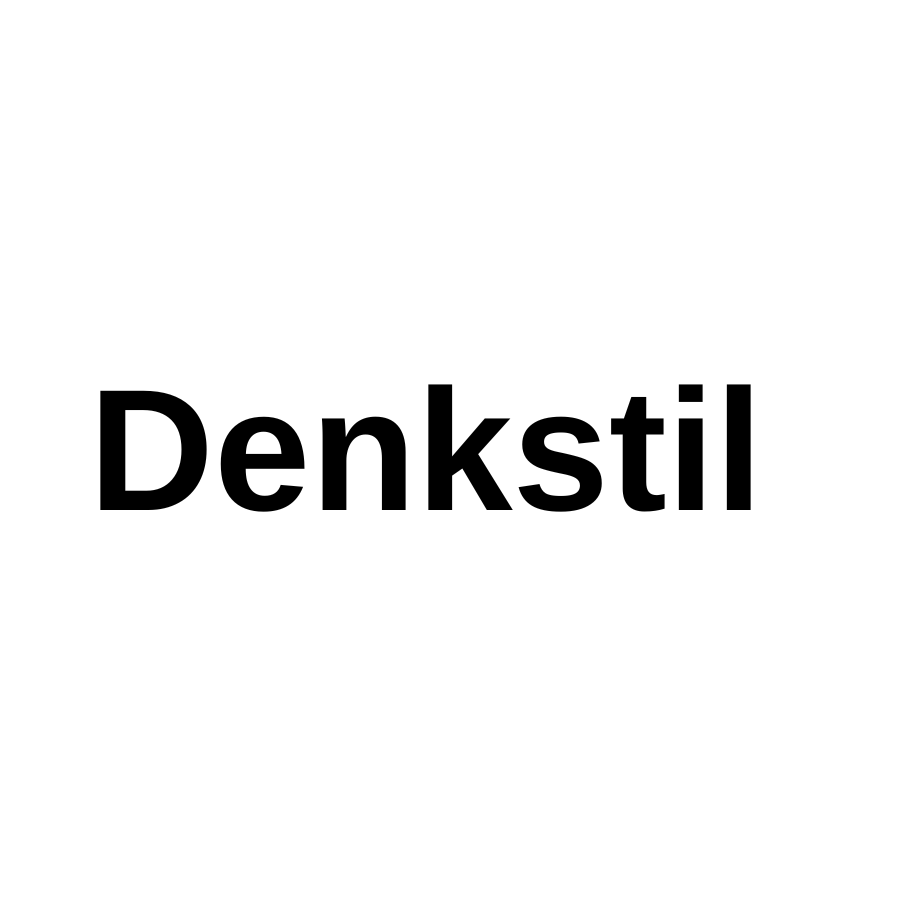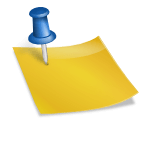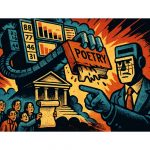Warum unterstützen westliche Intellektuelle immer wieder Bewegungen, die ihre eigenen Werte ablehnen? Der polnische Philosoph Leszek Kołakowski analysierte dieses Paradox schon vor Jahrzehnten – und seine Diagnose ist heute aktueller denn je. Ein Beitrag über die gefährliche Sehnsucht nach totalem Engagement, die Faszination des Anti-Intellektualismus und die Frage, warum aufgeklärte Menschen manchmal ihre eigenen Henker unterstützen.
Die Anziehungskraft der „gesunden Barbarei“
Es ist ein Phänomen, das sich durch die Geschichte zieht wie ein roter Faden: Intellektuelle, groß geworden in den Traditionen der westlichen Aufklärung, wenden sich von ihren eigenen kulturellen Wurzeln ab und werfen sich autoritären, oft antirationalen Bewegungen in die Arme. Leszek Kołakowski hat diese paradoxe Haltung prägnant beschrieben: „Was immer die Erklärung ist, man kann überzeugt sein, dass jede religiöse oder soziale Bewegung, mag sie auch den aggressivsten Anti-Intellektualismus predigen, begeisterte Unterstützung durch einige Intellektuelle finden wird, die in der bürgerlichen Zivilisation des Westens groß geworden sind und deren Werte ostentativ verwerfen, um sich der Herrlichkeit gesunder Barbarei zu beugen.“
Diese Beobachtung wirkt zunächst wie ein Widerspruch in sich. Wie kann jemand, der im Geist kritischer Rationalität erzogen wurde, sich Bewegungen anschließen, die genau diese Rationalität bekämpfen? Die Antwort liegt in einer gefährlichen Mischung aus Selbstkritik, Kulturmüdigkeit und der Sehnsucht nach emotionaler Authentizität. Der Anti-Intellektualismus wirkt dabei als verführerische Reizfigur: Er verspricht Befreiung vom vermeintlichen Spießertum des bürgerlichen Lebens, Klarheit statt Ambivalenz, totales Engagement statt zweifelnder Distanz.
Das Unbehagen an der Universalität
Kołakowski identifiziert einen fundamentalen Konflikt in der westlichen Kultur: Sie beruht auf der Annahme universell gültiger Werte – Menschenwürde, rationale Kritik, individuelle Freiheit. Doch genau diese Universalität steht im Widerspruch zum Bedürfnis nach „totalem Engagement“ oder „globaler Zugehörigkeit“ zu einer bestimmten Kultur, Subkultur oder militanten Gruppe.
„Der Glaube an die Allgemeingültigkeit gewisser kultureller Muster (eingeschlossene Denkmuster) läuft dem Bedürfnis nach ‚totalem Engagement‘ oder ‚globaler Zugehörigkeit‘ zu einer bestimmten Kultur oder Subkultur oder militanten Gruppe entgegen“, schreibt Kołakowski. Und weiter: „Vorbehaltloses Engagement fällt schwer, wenn wir uns bewusst sind, mit unseren Feinden einige grundlegende Werte gemein zu haben – selbst intellektuelle.“
Hier liegt der Kern des Problems: Wer radikal sein will, wer sich einer Sache mit Haut und Haaren verschreiben möchte, empfindet die eigene Reflexionsfähigkeit als Hindernis. Das Bewusstsein, dass selbst der politische Gegner Anteil an den gleichen universellen Werten hat, stört die Reinheit des Engagements. Es bleibt ein Rest an gemeinsamer Basis, der das absolute Abgrenzen erschwert – und genau dieser Rest wird als Belastung empfunden.
Das aktuelle Paradox: Wenn Identitätspolitik totalitär wird
Nirgendwo zeigt sich dieses Phänomen deutlicher als in der gegenwärtigen Debatte um queere Solidarität mit Gruppen und Bewegungen, die LGBTQ+-Rechte fundamental ablehnen oder aktiv bekämpfen. Doch das Paradox reicht tiefer: Die Haltung selbst, die zu dieser widersprüchlichen Solidarität führt, trägt bereits Züge totalitären Denkens in sich.
Diese Form der Identitätspolitik folgt einem geschlossenen ideologischen System, das keinen Raum für Differenzierung lässt. Sie fordert „totales Engagement“ im Sinne Kołakowskis – eine globale Zugehörigkeit zu einem politischen Lager, die jede kritische Distanz als Verrat brandmarkt. Wer die eigene Gruppenzugehörigkeit absolut setzt und daraus ein unverrückbares Weltbild ableitet, bewegt sich bereits auf dem Terrain des Totalitären: Die Welt wird in Freund und Feind, Unterdrücker und Unterdrückte eingeteilt, nach einem starren Schema, das keine Ambivalenz duldet.
Das widersprüchliche Eintreten westlicher Queerer für politische oder religiöse Gruppierungen, die in ihren Herkunftsländern queeres Leben verfolgen, ist dann kein bloßer Denkfehler mehr – es ist die logische Konsequenz eines Denkens, das die universellen Werte der Aufklärung bereits aufgegeben hat zugunsten einer „qualitativ anderen Logik“. Diese neue Logik ordnet alles einem übergeordneten ideologischen Narrativ unter: Antikolonialismus, Antirassismus, Anti-Imperialismus werden zu absoluten Kategorien, vor denen selbst die elementarsten Rechte zurücktreten müssen.
Philosophische und politische Kommentatoren sprechen von selbstschädigendem Opportunismus, von einer „hämischen Allianz“ aus Identitätspolitik, radikalem Antirassismus und mangelnder kritischer Selbstreflexion. Doch präziser müsste man sagen: Diese Haltung ist selbst Ausdruck jener Verachtung des geistigen Erbes, vor der Kołakowski warnt. Sie verwirft die Instrumente rationaler Kritik, den Universalismus der Menschenrechte, die Fähigkeit zur Differenzierung – und ersetzt sie durch ein dogmatisches Schema, das keine Widersprüche mehr erkennen will oder kann.
Die Metapher von den „Helfern ihrer eigenen Henker“ ist in diesem Kontext oft zitiert – ein Zustand, in dem Solidarität zum eigenen Schaden betrieben wird, analog zu historischen Vorbildern wie dem Paradox der „nützlichen Idioten“ im Totalitarismus. Doch während die „nützlichen Idioten“ vergangener Zeiten oft naive Idealisten waren, zeigt sich heute eine noch gefährlichere Form: die bewusste Unterwerfung unter ein totalitäres Denkmuster, das die eigene Vernunft als Hindernis empfindet.
Auch Stimmen aus der queeren Community selbst warnen eindringlich: Solidarität mit Gruppen, die queeres Leben kategorisch ablehnen oder brutal verfolgen, ist nicht nur widersinnig, sondern kontraproduktiv für die eigene Sicherheit und politische Handlungsfähigkeit. Menschenrechtsorganisationen und internationale LGBTQ+-Aktivisten fordern mehr wirkliche Solidarität – mit verfolgten Queeren im arabischen, muslimischen und afrikanischen Raum, nicht mit repressiven Regimen oder politisch-ideologischen Bewegungen, die Menschenrechte missachten. Doch diese Stimmen stoßen auf eine ideologische Mauer, die sich aus dem totalitären Charakter der herrschenden Identitätspolitik selbst ergibt.
Die Gefahr der „qualitativ anderen“ Logik
Kołakowski warnt noch vor einer weiteren Gefahr: „Die Idee, dass die Menschheit sich von ihrem geistigen Erbe ‚befreien‘ und die ‚qualitativ andere‘ Wissenschaft oder Logik begründen solle, ist der Wegbereiter eines bildungsfeindlichen Despotismus.“
Diese Warnung trifft ins Mark gegenwärtiger Debatten. Wer das geistige und kulturelle Erbe der Aufklärung – kritische Rationalität, Wissenschaft, Humanismus – als überwunden betrachtet und durch eine völlig neue, „andere“ Form von Logik ersetzen will, ebnet den Weg für autoritäre Strukturen. Die großen antirationalen Bewegungen des 20. Jahrhunderts haben alle behauptet, das geistige Erbe „abzuschaffen“ und etwas radikal Neues zu schaffen. Das Ergebnis war regelmäßig Despotismus, Unterdrückung und Bildungsfeindlichkeit.
Wer das gesammelte geistige Wissen verachtet oder rationales Denken verneint, schafft Raum für Machtkonzentration bei selbsternannten „Wissenden“, Gurus oder autoritären Führern. Bildung verliert ihren Wert als geregelte Weitergabe von Erkenntnis und differenziertem Urteil – und wird ersetzt durch Indoktrination und Dogma. Die versprochene „qualitativ andere Logik“ entpuppt sich als Mittel zur Herrschaft über Denken und Leben.
Toleranz darf nicht zur Selbstaufgabe werden
Kołakowskis Analyse macht deutlich: Die intellektuelle Distanz, der Zweifel, das Wissen um gemeinsame Werte mit dem Gegner sind keine Schwäche, sondern ein Schutzwall. Sie verhindern absolutes, unkritisches Engagement und bewahren vor ideologischer Verblendung. Wer zu vorschnell die eigenen Werte verwirft und sich der „Herrlichkeit gesunder Barbarei“ hingibt, verliert nicht nur den kritischen Verstand, sondern riskiert, zum Werkzeug in den Händen autoritärer, intoleranter Bewegungen zu werden.
Das Bewusstsein gemeinsamer kultureller und intellektueller Muster mag unbequem sein – es mag das totale Engagement erschweren, das besonders in Krisenphasen charmant und verlockend erscheint. Aber genau dieses Bewusstsein bleibt als Störfaktor und Warnsystem gegen selbstschädigende Allianzen unverzichtbar.
Die Schlussfolgerung ist so einfach wie fundamental: Toleranz sollte nicht bedeuten, die eigenen grundlegenden Rechte und Werte aus falsch verstandener Solidarität aufs Spiel zu setzen. Wer das tut, beweist nicht moralische Überlegenheit, sondern einen Mangel an Realismus und kritischem Denken – und gefährdet das, wofür er eigentlich kämpft.
Das Erbe der Aufklärung, mit all seinen Widersprüchen und Unvollkommenheiten, bleibt der beste Schutz gegen die Verführung der Barbarei. Die Fähigkeit zum Zweifel, zur Selbstkritik und zur rationalen Auseinandersetzung ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Wer sie aufgibt, liefert sich und andere der Willkür aus – egal, wie verlockend das Versprechen von Klarheit und totalem Engagement auch klingen mag.
Quelle:
Leszek Kolakowski: Intellektuelle contra Intellekt