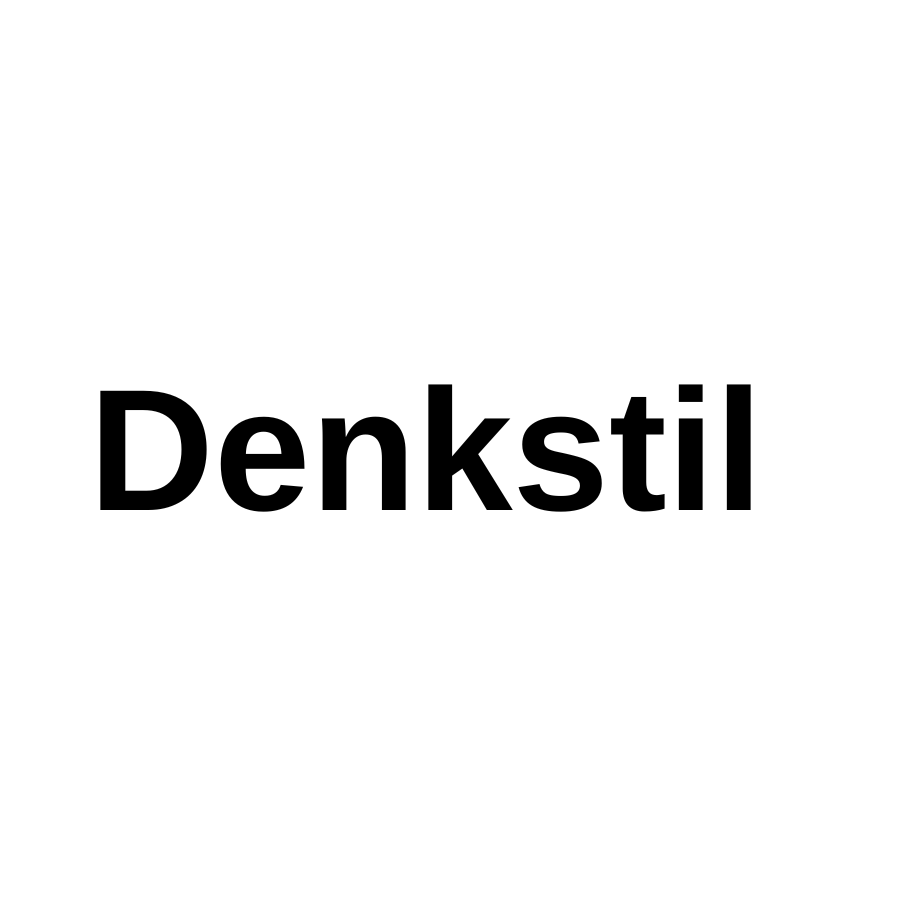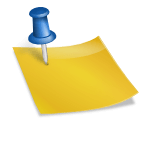Die Unterscheidung zwischen legitimen politischen Forderungen und ideologischen Absolutheitsansprüchen war einst konstitutiv für die bundesrepublikanische Debattenkultur. Heute ist sie verschwunden – mit verheerenden Folgen für die Streitfähigkeit der Demokratie.
Als Christian Graf von Krockow in den 1980er Jahren über die neuen sozialen Bewegungen schrieb, hatte er ein Problem im Blick, das ihn „vor dem Hintergrund deutscher Erfahrungen“ beunruhigte. Nicht die Inhalte der Umwelt- oder Friedensbewegung waren das Problem – der Vorrang des Umweltschutzes vor dem Wirtschaftswachstum, das Nein zur Kernenergie, all das waren legitime politische Ziele in einem freien Gemeinwesen. Das Problem lag woanders: in der Art, wie diese Ziele vertreten wurden. Die Bewegungen operierten mit „heils- und unheilsgeschichtlichen Perspektiven“, die zur bedingungslosen Identifikation drängten und politische Identität erst durch die Scheidung von Freund und Feind herzustellen schienen.
Von Krockow griff damit auf eine begriffliche Tradition zurück, die der SPD-Politiker und Rechtsphilosoph Adolf Arndt formuliert hatte: die Unterscheidung zwischen dem „Letzten“ und dem „Vorletzten“. Der soziale Staat und die menschenwürdige Gesellschaft seien ein Vorletztes, schrieb Arndt. Wer im Namen des Letzten – absoluter Wahrheit, höherer Moral – zu leben versuche, missachte das „uns anvertraute Diesseits“ und verfalle der Gefahr, nicht aus Wahrheit tätig zu sein, sondern mit dem zu wirken, „was sich an Brauchbarkeit mit der Wahrheit anfangen lässt“. Die Wahrheit werde dann zu etwas Fungiblem, zu einer Ideologie, zu einem „Instrumentarium der Außensteuerung“.
Diese analytische Schärfe ist aus dem deutschen Diskurs verschwunden. Und mit ihr die Fähigkeit zur Selbstreflexion über die eigenen Diskursmuster.
Was heute dominiert, ist ein Debattenstil, der permanent im Register des Absoluten operiert, ohne dies noch als Problem zu erkennen. Man kämpft für „die Wissenschaft“, „die Demokratie“, „die Freiheit“, „das Klima“ – jeweils als unbestreitbare letzte Instanz. Die Vorstellung, dass es im demokratischen Streit um konkurrierende Interpretationen dieser Begriffe gehen könnte, um Abwägungen im Raum des Politischen, ist fremd geworden. Stattdessen etabliert jede Seite ihre Version als sakrosankt und erklärt abweichende Positionen für illegitim.
Der Reflexionsverlust hat mehrere Dimensionen. Intellektuell ist eine ganze Tradition politischer Philosophie aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Arndt, Dolf Sternberger, Hermann Lübbe – diese Denker repräsentierten ein skeptisches, selbstkritisches Nachdenken über die Bedingungen demokratischer Streitkultur. Sie kannten die Gefahr, dass auch die eigene Seite in ideologische Selbstgerechtigkeit abdriften kann. Diese Form der politischen Philosophie wurde von einer empirisch-technokratischen Politikwissenschaft abgelöst, die Prozesse analysiert, aber keine normativen Kategorien mehr entwickelt. Die akademische Philosophie wiederum hat sich in Spezialdiskurse zurückgezogen, die außerhalb ihrer Zirkel kaum rezipiert werden.
Strukturell befördert die Fragmentierung der Öffentlichkeit genau jene „Außensteuerung“, vor der Arndt warnte. Jedes Milieu operiert in seiner Blase mit seinen Letztwahrheiten, jedes verfügt über seine eigenen Medien, seine Influencer, seine Empörungsrituale. Die Vorstellung eines gemeinsamen demokratischen Raums, in dem unterschiedliche Überzeugungen um Mehrheiten ringen, ohne sich gegenseitig die Legitimität abzusprechen, ist erodiert. An ihre Stelle ist ein Nebeneinander moralisch aufgeladener Lager getreten, die einander als Gefahr für das Gemeinwesen betrachten.
Besonders bitter ist die Ironie, dass gerade jene, die sich am lautesten auf „Demokratieverteidigung“ berufen, oft mit genau jenem Freund-Feind-Schema operieren, das Arndt als demokratiegefährdend identifiziert hatte. Wer von „Demokratiefeinden“ spricht, die „ausgegrenzt“ werden müssten, wer politische Gegner als „Delegitimierer“ denunziert, wer Kompromisse bereits als Verrat am Prinzip versteht – der macht genau das, was Arndt beschrieb: Er erhebt im Vorletzten, das der demokratischen Auseinandersetzung zukommt, eine letzte Wahrheit zum Maßstab und macht damit mitmenschliche Gemeinschaft unmöglich.
Die deutsche Neigung zum Prinzipienreiter-Modus verstärkt sich noch, wenn sie sich moralisch im Recht glaubt. Was fehlt, ist jenes skeptische Bewusstsein für die Selbstgefährdung des eigenen Milieus, das Krockow und Arndt auszeichnete. Beide waren politisch keineswegs neutral – aber sie begriffen, dass die größte Gefahr für die Demokratie nicht notwendig vom politischen Gegner ausgeht, sondern von der eigenen Unfähigkeit, zwischen legitimen politischen Positionen und illegitimen Absolutheitsansprüchen zu unterscheiden.
Arndt hatte gewarnt: „Weil letzte Ansprüche und Überzeugungen ihrem Wesen nach nicht mehrheitsfähig sind, können Mehrheitsentscheidungen gar nicht mehr hingenommen werden, wenn sie dem eigenen Zugriff auf absolute Moral, höhere Einsicht und Heilswahrheit widerstreiten.“ Diese Diagnose beschreibt heute nicht mehr nur die Ränder des politischen Spektrums, sondern zunehmend auch seine Mitte. Das Ergebnis ist eine Demokratie, in der zwar noch abgestimmt wird, deren Akteure aber die Legitimität von Mehrheitsentscheidungen nur noch dann anerkennen, wenn diese ihren eigenen Überzeugungen entsprechen.
Die Härte des Entweder-Oder, vor der Krockow warnte, erlaubt keine Illusionen. Eine Demokratie, die den Begriff des Vorletzten verloren hat, verliert die Fähigkeit zum Kompromiss. Und eine Gesellschaft, die nicht mehr zwischen politischem Streit und Glaubenskrieg unterscheiden kann, hat bereits aufgehört, eine demokratische zu sein.
Quelle:
Christian Graf von Krockow: Scheiterhaufen. Größe und Elend des deutschen Geistes