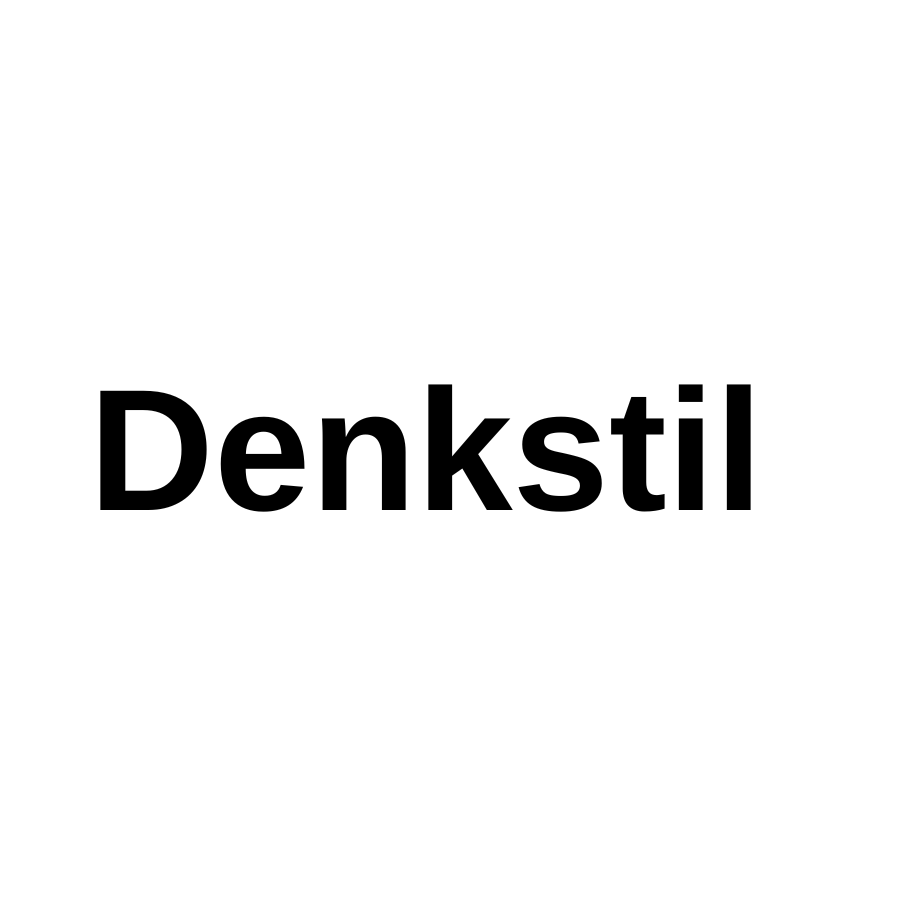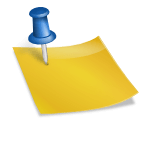Im April 1933 erschien eine Monographie über den vergessenen preußischen Staatsphilosophen Friedrich Julius Stahl. Der Verfasser war ein 24-jähriger Doktorand aus Frankfurt, dem Carl Schmitt gerade die Habilitation angeboten hatte. Wenige Wochen später stand das Buch auf der Liste der von den Nazis öffentlich zu verbrennenden Werke. Der Autor, Peter Drucker, verließ Deutschland innerhalb von 48 Stunden. Was steht in diesem Text, der Druckers intellektuelle Abrechnung mit dem konservativ-autoritären Denken seiner Zeit markiert – und der den Grundstein für sein späteres Lebenswerk legte?
Die Szene
Es ist Frühjahr 1933, wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung. In einem Hörsaal der Frankfurter Universität findet die erste Fakultätssitzung unter Nazi-Aufsicht statt. Ein Kommissar verkündet: Jüdische Professoren werden ab 15. März ohne Gehalt entlassen. Das Universitätsgelände ist für sie ab sofort gesperrt. Den verbleibenden Professoren verspricht er „viel Geld für rassisch reine Wissenschaft.“
Die Reaktion? Die meisten schweigen oder nicken. Einige wenige gehen mit ihren jüdischen Kollegen hinaus. Die Mehrheit aber, so erinnert sich Peter Drucker später, „hielt sicheren Abstand von diesen Männern, die nur wenige Stunden zuvor ihre engen Freunde gewesen waren.“
Drucker, damals junger Dozent und Journalist, sitzt im Publikum. Im Schockzustand fasst er einen Entschluss: Deutschland innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Was er tut.
Doch bevor er geht, vollendet er noch eine Arbeit: eine Monographie über Friedrich Julius Stahl, den konservativen Staatsphilosophen der Vormärz-Zeit. Carl Schmitt, bereits auf dem Weg zum „Kronjuristen des Dritten Reichs“, hatte ihm angeboten, die Habilitation zu betreuen. Drucker lehnt ab. Stattdessen schickt er das Stahl-Manuskript an den Verlag Mohr in Tübingen.
Am 26. April 1933 erscheint der Essay. Drucker schreibt später: „Das Buch wurde von den Nazis genau so verstanden, wie ich es beabsichtigt hatte; es wurde sofort verbannt und öffentlich verbrannt.“ Seine Losung sei nicht „rückwärts“ gewesen, sondern „durch“.
Der Text: Ein lebendiger Konservativismus
Was steht in diesem Essay, der als Frontalangriff auf den Nazismus verstanden wurde? Auf den ersten Blick: eine akademische Analyse des vergessenen Staatsdenkers Friedrich Julius Stahl (1802-1861), eines getauften Juden, der zum führenden konservativen Philosophen Preußens wurde.
Doch schon die Themenwahl ist eine Kampfansage. Einen jüdisch-stämmigen konservativen Denker als „Vorbild für die Turbulenzen der 1930er Jahre“ zu präsentieren – das war 1933 eine politische Provokation.
Druckers zentrale These: Stahl habe als erster die große Frage des Konservativismus im Zeitalter der Geschichte gestellt: Wie kann man an unveränderlichen Ordnungen festhalten und gleichzeitig geschichtliche Entwicklung anerkennen? Wie verbindet man Bewahrung mit Wandel, Autorität mit Freiheit, göttliche Ordnung mit menschlicher Tat?
Stahls Antwort war eine konstitutionelle Monarchie – ein System, das Autorität (beim Monarchen) und Freiheit (beim Volk) in höherer Einheit verband, moderiert durch die „öffentliche Gesinnung“ und rechtsstaatliche Bindungen.
Für Drucker war dies ein „lebendiger Konservativismus“ – im Gegensatz zur starren Restauration einerseits und zur zerstörerischen Revolution andererseits. Stahls Losung: nicht „rückwärts“, sondern „durch“.
Die philosophische Sprengkraft
Doch die eigentliche Brisanz liegt tiefer, in Druckers philosophischer Analyse. Denn im Kampf gegen Hegels Rationalismus entwickelt Stahl – und mit ihm der junge Drucker – eine Position, die 1933 hochaktuell war:
Gegen Hegels Dialektik setzt Stahl das Prinzip der „Polarität“. Nicht die Vernunft löst die Gegensätze auf (Dialektik), sondern ein irrationales Urprinzip – die schöpferische Persönlichkeit Gottes – verbindet sie. Einheit und Vielheit, Autorität und Freiheit, Bindung und Selbständigkeit sind nicht zu überwindende Gegensätze, sondern polare Spannungen, die in einer höheren Ordnung verbunden bleiben.
Das klingt abstrakt, ist aber hochpolitisch. Denn damit wendet sich Drucker gegen drei zeitgenössische Positionen zugleich:
- Gegen den liberalen Rationalismus: Die Vernunft allein genügt nicht. Der Mensch braucht Bindung, Autorität, transzendente Verankerung.
- Gegen den konservativen Irrationalismus (Heidegger): Aber die Vernunft darf nicht geleugnet werden! Kein „sacrificium intellectus“, keine Flucht in mythische Ursprünge.
- Gegen den autoritären Dezisionismus (Schmitt): Die Autorität muss in einer höheren Ordnung verankert sein, nicht in souveräner Entscheidung. Bindung, nicht Macht ist das Zentrum.
Drucker warnt explizit: Der Staat darf nicht „zur einzigen Bindung, zum ‚totalen Staat‘ werden“. Er braucht Pluralismus der Bindungen – Familie, Stand, Kirche, Nation.
Druckers Distanz zu Stahl: Die kritische Wende
Doch so bewundernd Drucker Stahls Versuch würdigt – er zeigt mit gnadenloser Klarheit, wo das System scheitert. Und diese Kritik ist der Schlüssel zu Druckers eigenem Denken.
Erstens: Stahl idealisiert eine bestimmte historische Situation. Er, „der Schüler der historischen Schule, vor der alles Gewordene gleich sein sollte“, erhebt „sich ständig Wandelndes zu unveränderlich Gültigem.“ Die konstitutionelle Monarchie mit starker monarchischer Spitze wird von einer zeitbedingten Form zur ewigen Wahrheit erklärt.
Drucker kommentiert scharf: „Gerade dieser Fehler ist es aber, dem sein System die politische Schlagkraft, die praktische Wirksamkeit verdankt.“ Man kann eben nicht Politik machen mit reiner „konservativer Resignation“. Aber man zahlt einen Preis: Das System verliert seine „Entwicklungsfähigkeit“.
Zweitens: Stahl hat einen fundamentalen logischen Widerspruch. Woher kommt die Autorität der Obrigkeit? Von Gottes Schöpfung? Dann müsste der Monarch dem Menschen übergeordnet sein wie Gott – was offensichtlich absurd ist. Stahl muss daher eine „Hilfskonstruktion“ einführen: die Sündhaftigkeit des Menschen macht Autorität notwendig.
Aber das, so Drucker vernichtend, würde bedeuten: „Im vollendeten sittlichen Reich, im Gottesreich, in dem die Menschen von ihrer Sündhaftigkeit erlöst sein werden, die Herrschaft Gottes überflüssig sein würde, was natürlich ein Hohn auf Stahls Voraussetzungen wäre.“
Die Autorität schwebt bei Stahl letztlich in der Luft. Sie ist weder aus der Schöpfung noch aus der Vernunft vollständig zu begründen.
Drittens – und das ist die vernichtendste Kritik: Der Protestantismus ist „seiner Natur nach anarchistisch.“
Hier trifft Drucker ins Mark. Luther hatte den Menschen auf sein eigenes Gewissen gestellt, auf die individuelle Schriftauslegung. Damit ist jede heteronome Ordnung prinzipiell angreifbar. „Die Rechtfertigung vor dem eigenen Gewissen muss jede heteronome Ordnung zerstören.“
Stahl versucht, dies zu kitten durch die Bindung an die göttliche Ordnung. Aber er bleibt „bewusster Protestant“ – und damit im Widerspruch gefangen. Daher die ständige Suche nach „zusätzlichen Bindungen“: bei Luther die Heilige Schrift, in der Orthodoxie die Bekenntnisse, in Preußen die „Staatsidee“ als persönliche Bindung der Armee an den König.
Drucker: „Daher kann es sich auch niemals zu jener überzeitlichen Höhe erheben, auf der die in der Ewigkeit der Kirche verankerten katholischen Sozialphilosophen stehen; denn jede protestantische Lehre muss, da sie der Nachprüfung im Gewissen jedes einzelnen unterworfen ist, notwendig zeitgebunden sein.“
Das ist brutal ehrlich: Stahls protestantischer Konservativismus ist ein Widerspruch in sich. Und Drucker weiß es.
Viertens: Stahl wurde selbst zum Reaktionär. Nach 1848, als seine Vision der konstitutionellen Monarchie bereits Wirklichkeit geworden war, hätte Stahl sich weiterentwickeln müssen. Stattdessen erstarrte er: „Indem Stahl weiter an seiner Lehre hing und sie als das zu Erreichende hinstellte, vermaß er sich, die historische Entwicklung aufzuhalten und wurde dadurch aus dem Konservativen zum Reaktionär.“
Der Mann, dessen Losung „durch“ war, wollte plötzlich zurück. Als er 1861 starb, waren „seine eigenen Ideen in mächtiger Fortentwicklung bereits über ihn hinweggegangen.“
Fünftens: Stahl sah die wirklich wichtigen Fragen nicht. Drucker ist schonungslos: „Stahl hat weder das Problem der Außenpolitik, noch die soziale Frage gesehen.“ Diese „Fehler haben sein System noch mehr vereinfacht und so die Wirkung noch gesteigert, allerdings auf Kosten der Entwicklungsfähigkeit der Lehre.“
Das ist keine Nebensache. Die soziale Frage – der Aufstieg der Arbeiterklasse, die Industrialisierung – war die Frage des 19. Jahrhunderts. Stahl ignorierte sie. Genauso die Frage nationaler Macht und internationaler Ordnung.
Was Drucker behält – und was er verwirft
Aus dieser vernichtenden Kritik rettet Drucker nur weniges – aber dieses Wenige ist fundamental:
Er behält:
- Das Prinzip der Polarität statt Dialektik
- Die Anerkennung irrationaler Bindungen ohne Vernunftopfer
- Den dynamischen Konservativismus: Bewahren UND Wandel
- Den Pluralismus der Bindungen gegen den totalen Staat
- Die Idee der lebendigen Form statt toter Verfassung
Er verwirft:
- Die religiöse Fundierung (zu zeitgebunden, zu widersprüchlich)
- Die Idealisierung einer Staatsform (Monarchie)
- Die Legitimation von Autorität durch göttliche Ordnung
- Die Vernachlässigung der sozialen und internationalen Frage
- Den protestantischen Konservativismus als solchen
Was bleibt? Eine Methode, keine Metaphysik. Ein Ansatz zur Balance von Gegensätzen, keine ewige Wahrheit. Eine Heuristik für funktionale Ordnungen, kein Gottesstaat.
Und vor allem: Die Einsicht, dass man Stahl 1933 nicht mehr brauchen kann. Seine Stunde war 1848. Jetzt, 1933, ist eine andere Antwort nötig.
Der entscheidende Unterschied
Hier liegt der fundamentale Bruch mit Schmitt und Heidegger. Beide glaubten 1933, sie könnten den Nationalsozialismus intellektuell „führen“ und in zivilisierte Bahnen lenken. Beide boten dem Regime ihre Dienste an – Schmitt als Jurist, Heidegger als Rektor.
Drucker sah sofort: Das ist der Weg in die Katastrophe.
Im Stahl-Essay schreibt er (wohlgemerkt: im April 1933, vor der vollen Entfaltung des NS-Terrors): Die Gefahr besteht darin, dass „blinde Verteidigung des Gestrigen“ (Reaktion) und die Hoffnung, durch einen starken Staat Ordnung zu schaffen, „gerade dadurch zum Überschlagen in das andere Extrem, in die Revolution führt.“
Drucker hatte verstanden, was Schmitt und Heidegger nicht sehen wollten: Der autoritäre Konservativismus ist kein Bollwerk gegen, sondern eine Rampe zum Totalitarismus.
Aber er hatte auch verstanden – und das unterscheidet ihn von den naiven Liberalen – dass der Liberalismus allein keine Antwort ist. Man kann nicht zurück zum wirtschaftsliberalen 19. Jahrhundert. Man braucht neue Formen der Bindung, der Gemeinschaft, der Autorität.
Nur eben nicht die alten. Und nicht die autoritären.
Die persönliche Dimension
Die Ablehnung war nicht nur intellektuell, sondern zutiefst moralisch. Edmund Husserl hatte Heidegger zu seinem Nachfolger in Freiburg gemacht, ihm seine Karriere gewidmet. Heidegger dankte es ihm, indem er als Rektor Husserl 1933 den Zugang zur Universität verbot, die Widmung in „Sein und Zeit“ entfernen ließ und den alten Mann isolierte. Husserl starb 1938 einsam und verbittert.
Für Drucker, der in Frankfurt selbst erlebt hatte, wie Kollegen ihre jüdischen Freunde „fallen ließen“, war dies der ultimative Beweis: Charakterstärke ist wichtiger als intellektuelle Brillanz. Treue, Verantwortung, Anstand – das sind keine antiquierten Tugenden, sondern existenzielle Notwendigkeiten.
Der Unterschied zwischen Drucker und den konservativ-autoritären Denkern war nicht nur theoretisch. Es war der Unterschied zwischen einem, der innerhalb von 48 Stunden emigrierte, und denen, die blieben und sich arrangierten.
„The End of Economic Man“ – Die Fortführung
Im Londoner Exil schreibt Drucker 1939 sein erstes englisches Buch: „The End of Economic Man – The Origins of Totalitarianism“. Es ist die Fortsetzung der Stahl-Analyse mit anderen Mitteln – und eine indirekte Abrechnung mit dem konservativ-autoritären Denken.
Die zentrale These: Der Totalitarismus entstand nicht trotz, sondern wegen des Zusammenbruchs sowohl des ökonomischen Liberalismus als auch des traditionellen Konservativismus. Die Massen wandten sich „dämonischen Kräften“ zu, als beide Credos versagten.
Zwei Kapitel tragen die Titel „The Despair of the Masses“ und „The Return of the Demons“ – Begriffe, die damals ungewöhnlich waren, aber eine Dekade später im Existentialismus Mode wurden. Drucker benutzte bereits Kierkegaard als politischen Denker, aber anders als Heidegger lehnte er die existentialistische Lösung ab.
Seine Analyse: Die Nazis schufen eine „non-economic society“ – eine militarisierte Wehrwirtschaft, die nicht primär ökonomischen, sondern psychologischen Zwecken diente. Als ein Nazi-Redner verkündete: „Wir wollen keine höheren Fleischpreise. Wir wollen keine niedrigeren Fleischpreise. Wir wollen nationalsozialistische Fleischpreise!“ – da war der „economic man“ zu Ende.
Der Totalitarismus appelliert nicht an Vernunft oder Interesse, sondern an Identität, Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Bedeutung. Das ist seine Stärke – und seine Gefahr.
Der dritte Weg
Aus diesem doppelten Scheitern – des Liberalismus und des autoritären Konservativismus – entwickelt Drucker seinen eigenen Weg. Nicht mehr „konservativ“ im traditionellen Sinne, aber auch nicht liberal-individualistisch. Und vor allem: Nicht mehr religiös fundiert.
Seine Lösung: Institutioneller Pluralismus.
- Keine totale Bindung an den Staat, sondern vielfältige Bindungen
- Keine isolierten Individuen, sondern Einbettung in funktionale Gemeinschaften
- Keine souveräne Entscheidung, sondern Verantwortung in Institutionen
- Keine Dialektik oder Dezisionismus, sondern Polarität und Balance
- Keine metaphysische Fundierung, sondern funktionale Legitimation
Das ist die Brücke von Stahl 1933 zu Drucker dem Management-Denker. Die „Society of Organizations“, die Betonung intermediärer Institutionen, die Theorie verantwortungsvoller Führung – all das wurzelt in der Erkenntnis von 1933: Wir brauchen Bindung, aber nicht totale Bindung. Autorität, aber rechtsgebundene Autorität. Gemeinschaft, aber pluralistische Gemeinschaft.
Und: Wir brauchen keine ewigen Wahrheiten mehr. Wir brauchen funktionierende Institutionen. Das ist Druckers radikaler Pragmatismus – geboren aus der Katastrophe von 1933.
Die Aktualität
Warum ist das heute relevant? Weil wir wieder in einer Zeit der Polarisierung leben, in der:
- Autoritäre Versuchungen wachsen („Nur ein starker Führer kann uns retten“)
- Liberale Ordnungen unter Druck stehen (Identitätskrise, Populismus)
- Konservative zwischen Restauration und Wandel schwanken
- Religiöse Fundierungen nicht mehr tragen (Säkularisierung)
Druckers Antwort von 1933 bleibt aktuell: Der Weg ist weder „rückwärts“ noch der Sprung ins Irrationale, sondern „durch“ – durch organische Weiterentwicklung, durch Balance von Bewahren und Erneuern, durch Bindung in Freiheit.
Aber – und das ist die moralische Lektion – dieser Weg erfordert Charakterstärke. Die Bereitschaft, im entscheidenden Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Innerhalb von 48 Stunden. Und die intellektuelle Redlichkeit, auch die eigenen Helden zu kritisieren.
Schmitt und Heidegger wollten klüger sein als die Geschichte. Sie glaubten, sie könnten den Tiger reiten. Drucker wusste: Manche Angebote lehnt man ab. Manche Brücken brennt man hinter sich ab. Und manche Theorien muss man aufgeben, auch wenn sie elegant sind.
Das ist die wahre Lehre des Stahl-Essays: Konservativismus ohne moralischen Kompass ist nicht konservativ, sondern reaktionär – und am Ende revolutionär in seiner Zerstörungskraft. Und: Konservativismus auf protestantisch-religiöser Basis ist ein Widerspruch in sich. Man braucht neue Fundamente.
Epilog: Das verbrannte Buch
Von Druckers Stahl-Essay existiert vermutlich nur noch eine Handvoll Exemplare. Die Nazis haben ganze Arbeit geleistet. Aber die Ideen darin – die leben. In jedem Text über verantwortungsvolle Führung, über die Grenzen des Staates, über die Bedeutung intermediärer Institutionen.
Und in der Methode: Bewunderung ohne Blindheit. Würdigung ohne Identifikation. Lernen von der Geschichte, ohne sie zu wiederholen
Der 24-jährige, der 1933 Deutschland verließ, wurde nicht zum verbitterten Emigranten, sondern zum Architekten einer neuen Ordnung – einer Ordnung jenseits von Staat und Markt, jenseits von Gott und Vernunft, verankert in funktionalen Gemeinschaften und gelebter Verantwortung.
Seine Losung von 1933 blieb sein Lebensthema: Nicht rückwärts. Nicht stehen bleiben. Sondern durch. Aber anders als Stahl es sich vorgestellt hatte.