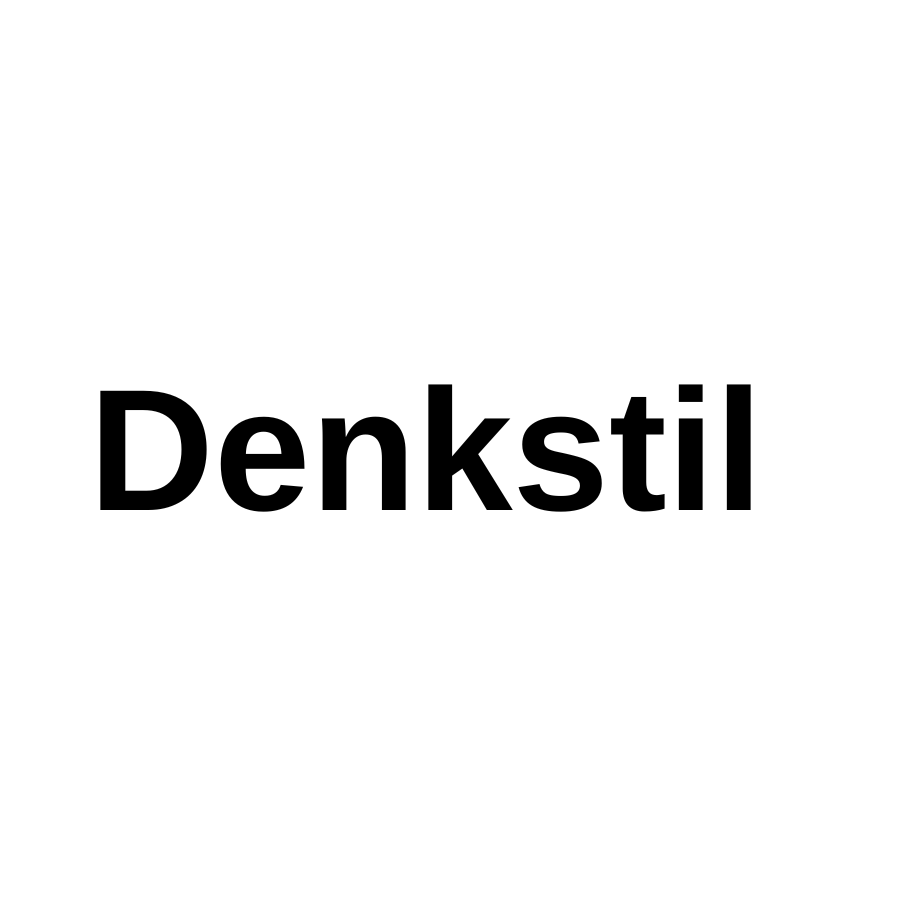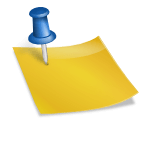Ob Universitäten, Städte oder gar das Glück selbst – nichts scheint sich mehr der Vermessung und Bewertung zu entziehen. Doch Rankings sind weder neutral noch objektiv. Sie sind Instrumente der Macht, die unsere Weltsicht verengen und komplexe Realitäten auf schlichte Zahlenreihen reduzieren. Während erste Universitäten aus den großen Rankings aussteigen, erobern KI-Algorithmen die Arbeitswelt und entscheiden über Karrieren. Ein Beitrag über die Herrschaft der Zahlen und die verborgenen Interessen hinter vermeintlich wissenschaftlichen Ranglisten.
Die Szene, die alles sagt
Es ist eine der einprägsamsten Szenen der Filmgeschichte: In Der Club der toten Dichter fordert der Englischlehrer John Keating seine verdatterten Schüler auf, die Seiten über die „wissenschaftliche“ Bewertung von Lyrik aus ihren Büchern zu reißen. „Wir sind keine Klempner, wir haben es hier mit Lyrik zu tun“, erklärt er. „Man kann doch nicht Gedichte bemessen wie amerikanische Charts.“ Robin Williams‘ Figur wehrt sich gegen das, was heute allgegenwärtig scheint: den Zwang, alles und jedes in eine Rangfolge zu pressen.
Doch während Keating noch die Freiheit der Kunst gegen die Tyrannei der Messbarkeit verteidigte, scheint unsere Gegenwart von einem geradezu unstillbaren Hunger nach Rankings getrieben. Fast täglich schwemmt eine neue Flut von Bestenlisten durch die Medien. Städte, Länder, Universitäten, Bibliotheken, Anwaltskanzleien – selbst abstrakte Konzepte wie Glück oder „Lebenszufriedenheit“ werden erfasst, gewogen und in eine Hierarchie gezwungen. „Rank Stupidity“ könnte man diese Sucht nach einfachen Ordnungen in komplexen Zeiten nennen – eine kollektive Verengung unserer Weltsicht, die kritisches Denken durch die scheinbare Sicherheit von Zahlen ersetzt.
Eine Genealogie der Vermessung
Wer glaubt, diese Vermessungswut sei ein Phänomen der Moderne, irrt. Bereits 1708 entwickelte der französische Künstler Roger de Piles ein ausgeklügeltes System, um Maler in eine Rangfolge zu bringen. Doch die Wurzeln reichen noch tiefer: Im späten Ancien Régime begannen Herrscher, das Glück ihrer Untertanen statistisch zu erfassen – ein frühes Kapitel sozialer Kontrolle durch Zahlen. Die Kulturgeschichte der Statistik vom 18. bis zum 20. Jahrhundert offenbart, wie aus Verwaltungsinstrumenten mächtige Werkzeuge der Welterfassung wurden, die moderne Wissensordnungen und Machtstrukturen stabilisierten.
Die Frage „Rang oder Ranking?“ führt uns zurück in die Vormoderne und zeigt: Der menschliche Drang zum Vergleichen ist alt, doch seine Techniken und Implikationen haben sich fundamental gewandelt. Was einst kontextgebundene, qualitative Rangbestimmungen waren, ist heute zur standardisierten, quantitativen Massenproduktion geworden. Das Vergleichen selbst, so wird in kulturwissenschaftlichen Analysen deutlich, ist eine Kulturtechnik, durch die Gesellschaften sich selbst und andere begreifen – mit allen Verzerrungen und blinden Flecken, die dieser Prozess mit sich bringt.
Die Numerokratie: Wenn Algorithmen herrschen
Willkommen in der Numerokratie – der Herrschaft der Zahlen. Algorithmen durchdringen heute Politik, Gesellschaft und Alltag mit einer Selbstverständlichkeit, die kaum noch hinterfragt wird. Ein Viertel der europäischen Unternehmen nutzt bereits Algorithmen oder KI, um Managemententscheidungen zu automatisieren – von der Personalbeschaffung über die Arbeitszeitplanung bis zur Leistungsbewertung. Die Zahl wird in den nächsten zehn Jahren rapide ansteigen. Euronews Rankings sind dabei nur die sichtbare Spitze eines Systems, das komplexe Realitäten auf berechenbare Einheiten reduziert.
Europäische Gewerkschaften beklagen, dass neue Algorithmen zur Leistungsmessung oft eingeführt werden, ohne die Arbeitnehmer darüber zu informieren. In vielen Fällen sammeln die Algorithmen sogar Daten, die sie nicht sammeln sollten, wie etwa zur psychischen Gesundheit.
Ein besonders problematisches Beispiel findet sich im Wissenschaftsbetrieb selbst. Die meistzitierten Studien der Wissenschaftsgeschichte, wie sie etwa Nature ermittelt hat, gelten als Gipfel der Forschungsleistung. Doch was sagt die Häufigkeit von Zitaten wirklich über wissenschaftlichen Wert aus? Oft nicht mehr als die Zugehörigkeit zu einflussreichen Netzwerken, die Trendkonformität einer These oder schlicht die Zugänglichkeit einer Publikation. Der Zitationsindex, ursprünglich als Orientierungshilfe gedacht, ist längst selbst zum Steuerungsinstrument geworden, das Forschungsagenden prägt und Karrieren bestimmt.
Revolte gegen die Ranglisten: Erste Universitäten steigen aus
Doch es regt sich Widerstand. Im März 2024 vollzog die Universität Zürich einen bemerkenswerten Schritt: Sie zog ihre Teilnahme am renommierten Times Higher Education Ranking zurück. Die Begründung: Das Ranking setze falsche Anreize für die Wissenschaft und könne die vielfältigen universitären Leistungen in Forschung und Lehre nicht umfassend messen.
Die Universität Zürich berief sich dabei auf die Coalition for Advancing Research Assessment der European Science Foundation, eine internationale Vereinbarung zur Reform der Evaluation von Forschungsleistungen. Diese wurde von 800 forschungsnahen Organisationen weltweit unterzeichnet, darunter auch die Universitäten Lausanne, Freiburg und Genf sowie die ETH Zürich. Ein zentraler Grundsatz dieser Vereinbarung lautet: Rankings bei der Beurteilung von Forschungsleistungen zu vermeiden.
Dieser Ausstieg ist mehr als eine symbolische Geste. Er markiert einen Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit der Ranking-Industrie. Die kritische Stimme aus Zürich wird lauter in einem Konzert der Kritik, das längst nicht mehr zu überhören ist. Dennoch bleiben viele Universitäten dabei: Die ETH Zürich etwa teilt zwar die kritische Sicht, plant aber keine Beendigung der Zusammenarbeit. Rankings erhöhten die internationale Sichtbarkeit und führten dazu, dass die besten Talente weltweit die Institution als Top-Universität wahrnähmen. Die Frage der Reputation scheint schwerer zu wiegen als die nach der Wahrhaftigkeit der Messung.
Die Macht der Stiftungen – Das Beispiel Bertelsmann
In Deutschland ist die Bertelsmann-Stiftung mit ihrem Ableger CHE zu einer wahren Quelle solcher Rankings geworden. Doch die Kritik an ihren Methoden ist längst nicht mehr zu überhören. Was treibt Stiftungen wie Bertelsmann, Bosch oder Mercator eigentlich an? Die Grenze zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse verschwimmt, wenn private Akteure über Studien, Netzwerke und gezielte Agendasetzung die Bildungspolitik beeinflussen. Stiftungen werden so zu heimlichen Architekten der Bildung – ohne demokratische Legitimation, aber mit erheblichem Einfluss.
Im Fall Bertelsmann stellt sich eine besonders brisante Frage: Inwieweit wird hier Unternehmensinteresse mit Gemeinwohl verwechselt – oder gar bewusst gleichgesetzt? Die strukturelle Verflechtung ist eng: Die Bertelsmann Stiftung ist Hauptanteilseigner des Bertelsmann-Konzerns, die Familie Mohn kontrolliert beides. Der Konzern selbst hat in den letzten zwei Jahrzehnten den Anschluss an die digitale Entwicklung weitgehend verloren.
Das Lycos-Engagement ist dafür symptomatisch.Trotz aller Restrukturierungen blieb Lycos Europe jahrelang defizitär. Gegen die Übermacht von Google und anderen US-Playern konnte der europäische Markt nie erobert werden. 2008 war das Ende besiegelt: 500 von 700 Mitarbeitern verloren ihre Jobs, einzelne Geschäftsfelder wurden verkauft, der Rest abgewickelt. Rund 50 Millionen Euro wurden an die Aktionäre verteilt. Das operative Geschäft aber endete im Totalschaden. Lycos Europe war das prominenteste Beispiel für die gescheiterten Internet-Pläne Bertelsmanns. Während Tech-Konzerne wie Google, Amazon oder Netflix Medien und Bildung revolutionierten, blieb Bertelsmann in traditionellen Geschäftsfeldern stecken. Seit vielen Jahren stagniert der Umsatz von Bertelsmann – inflationsbereinigt ist er rückläufig.
Es entsteht der Eindruck, als wolle der Konzern seine stark schwindende wirtschaftliche Bedeutung über den Umweg der Stiftung kompensieren – und sich durch deren Einfluss auf Bildungs- und Gesellschaftspolitik eine Relevanz sichern, die ihm am Markt zusehends entgleitet. Die Stiftung wird zum Vehikel, um trotz wirtschaftlicher Rückschläge weiterhin mitzubestimmen, wie Bildung, Demokratie und Gesellschaft organisiert werden sollen. Was als gemeinnützige Arbeit präsentiert wird, dient dabei nicht zuletzt der Aufrechterhaltung von Einfluss und Deutungshoheit.
Im September 2024 kritisierte die Neue Zürcher Zeitung die Bertelsmann Stiftung scharf wegen ihres „Bürgerrats gegen Fake News“. Die Hoffnung der Stiftung auf eine „unparteiische künstliche Intelligenz“, die Desinformation erkenne und kennzeichne, sowie eine „zentrale Stelle“, die Bürger und Journalisten berät und strafrechtliche Sanktionen ersinnt, sei „technisch naiv und politisch mindestens im Ansatz totalitär“ – vergleichbar mit dem „Ministerium für Wahrheit“ aus George Orwells Dystopie „1984″. NZZ Für den Medienkonzern Bertelsmann mag es dabei erfreulich sein, wenn verpflichtende Unterrichtsmodule zum Thema „Medienkompetenz“ gefordert werden – ein Geschäftsfeld, in dem das Unternehmen nach wie vor tätig ist.
Der Wert von Bertelsmann-„Studien“ ist entsprechend umstritten. Kritiker sprechen von „Opium für die Mächtigen“ – Berichte, die als politisches Beruhigungsmittel für Eliten fungieren und bequeme Erzählungen liefern, wo empirische Komplexität angebracht wäre.
Das CHE-Hochschulranking läuft trotz langjähriger Kritik weiter. Bemerkenswert ist, dass die Soziologie nach jahrelangem Boykott 2024/25 wieder am Ranking teilnimmt – allerdings mit einer Rücklaufquote von nur 14 Prozent. Angesichts der schlechten Gesamtrücklaufquote wurde vom Fachbeirat ausnahmsweise toleriert, Ergebnisse auszuweisen, obwohl die eigentlich geltenden Kriterien nicht erfüllt waren. Diese Zahlen sprechen Bände über die Akzeptanz des Rankings in der scientific community.
Doch die Verantwortung liegt nicht allein bei den Erstellern solcher Rankings – auch die Medien tragen Schuld. Wenn Redaktionen Ranglisten unkritisch weitertragen, wird Wissenschaft zur medialen Inszenierung, und der öffentliche Diskurs verarmt.
Das Unsichtbare hinter den Zahlen
Die Wahrheit ist unbequem: Kein Ranking ist frei von Interessen. Jedes ist durchzogen von blinden Flecken, von Vorannahmen, von Versuchsanordnungen, die bereits eine bestimmte Richtung vorgeben. Der Philosoph Hans Jörg Sandkühler macht deutlich, wie stark Forschergemeinschaften von unsichtbaren Faktoren geprägt sind: Ein bestimmter „epistemischer Habitus“, kulturspezifische Praktiken, weltbildabhängige Vorannahmen, anerkannte Normen und Regeln – all dies fließt ein in das, was dann als „objektives“ Ergebnis präsentiert wird.
Selbst scheinbar unverdächtige Darstellungsformen wie Landkarten sind, wie Thomas Macho eindrücklich zeigt, alles andere als „objektiv“. Die Projektion, die Wahl des Zentrums, die Größenverhältnisse – all das transportiert Weltbilder und Machtverhältnisse. Wenn schon Kartografie nicht neutral sein kann, wie viel mehr gilt das dann für Rankings, die das Abstrakte und Qualitative in Zahlen zwingen?
Besonders absurd wird es bei Versuchen, Glück international zu messen. Globale Glücksindices bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen wissenschaftlicher Methodik und kultureller Beliebigkeit. Was in Skandinavien als Lebensqualität gilt, mag in anderen Kulturen ganz anders definiert werden. Die Standardisierung macht den Vergleich möglich – aber um den Preis, dass die spezifische Bedeutung des Verglichenen verloren geht.
Die KI-Wende: Von Rankings zu algorithmischem Management
2025 erleben wir eine neue Eskalationsstufe der Vermessung: Künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend die Rolle des Bewerters. KI-Suchmaschinen wie ChatGPT Search oder Google AI Overviews entscheiden, welche Informationen wir sehen. KI-Systeme bewerten Bewerbungen, überwachen Arbeitsleistung, berechnen Kreditwürdigkeit. Die Algorithmen sind komplexer geworden, ihre Entscheidungen undurchsichtiger – und ihr Einfluss auf unser Leben größer denn je.
Die EU-Kommission stellt fest, dass bestehende Rechtsvorschriften zwar einige Fragen des algorithmischen Managements abdecken, etwa Arbeitsintensität und Transparenz, dass aber noch erhebliche Lücken bestehen. Gewerkschaften fordern eine neue EU-Richtlinie zum Schutz der Arbeitnehmerrechte und mahnen: „Es ist an der Zeit, dass die Unternehmen verstehen, dass sie Managemententscheidungen nicht hinter den Algorithmen verstecken können.“
Die Hoffnung, dass KI-Rankings objektiver seien als menschengemachte, erweist sich als Illusion. Algorithmen reproduzieren und verstärken die Vorurteile ihrer Schöpfer. Sie operieren nach Kriterien, die oft im Verborgenen bleiben. Und sie schaffen eine neue Form der Intransparenz: Wer kann schon nachvollziehen, warum ein neuronales Netz eine bestimmte Entscheidung getroffen hat?
Selbst die Bewertung von KI-Systemen erfolgt inzwischen durch Rankings. Plattformen wie lmarena.ai lassen Nutzer verschiedene KI-Modelle gegeneinander antreten und erstellen Ranglisten nach Benutzer-Präferenzen. Doch auch hier gilt: Die Kriterien sind subjektiv, die Testszenarien selektiv, die Ergebnisse Momentaufnahmen in einem sich rasant verändernden Feld. Was heute als bestes Modell gilt, kann morgen überholt sein – nicht weil es schlechter wurde, sondern weil sich die Maßstäbe verschoben haben.
Alternativen: Die Wiederentdeckung des Qualitativen
Muss es so sein? Gibt es Alternativen zum Hochschulranking, ganz ohne Punkte? Tatsächlich mehren sich die Stimmen, die für qualitative Bewertungen plädieren. Statt Universitäten in eine starre Hierarchie zu pressen, könnte man ihre unterschiedlichen Profile herausarbeiten, ihre spezifischen Stärken benennen, kontextuelle Informationen liefern. Das wäre aufwendiger, differenzierter – und gerechter.
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann hat dieser Ranking-Gläubigkeit mit seinem bissigen Essay „Der Weisheit letzter Stuss“ den Spiegel vorgehalten. Seine Kritik zielt ins Herz des Problems: Rankings suggerieren Objektivität, wo tatsächlich Konstruktion herrscht. Sie versprechen Orientierung, liefern aber oft nur Verwirrung. Und sie behaupten, Komplexität zu reduzieren, während sie in Wahrheit Komplexität vernichten.
Die Coalition for Advancing Research Assessment zeigt, dass Alternativen möglich sind. Ihre zehn Grundsätze fordern eine Reform der Forschungsevaluation, die qualitative Aspekte stärker berücksichtigt, kontextuelle Faktoren einbezieht und die Vielfalt wissenschaftlicher Leistungen würdigt. Dass 800 Organisationen weltweit diese Prinzipien unterzeichnet haben, deutet auf einen beginnenden Paradigmenwechsel hin – auch wenn die praktische Umsetzung vielerorts noch auf sich warten lässt.
Die Frage nach den Interessen
Mit dem Ökonomen Albert O. Hirschman wäre also zu fragen: Welche Interessen, welche Annahmen, welches Weltbild verbergen sich hinter den scheinbar neutralen Zahlenkolonnen? Diese Frage wird umso dringlicher, wenn Rankings, wie im Fall von „Deutschlands Beste“ beim ZDF nachweislich manipuliert wurden. Transparenz, jenes Zauberwort der Ranking-Apologeten, erweist sich dann als hohle Phrase.
Gegen das Erstellen und Veröffentlichen von Rankings ist zunächst nichts einzuwenden. Problematisch wird es erst, wenn sie mit dem Anspruch auftreten, den alleingültigen Maßstab zu liefern, an dem sich alle anderen zu orientieren haben – bei Androhung des Vorwurfs, objektiven wissenschaftlichen Erkenntnissen ihre Berechtigung abzusprechen. Noch problematischer wird es, wenn Rankings zu Steuerungsinstrumenten werden, die das Verhalten der Bewerteten prägen: Universitäten, die ihre Strukturen nach Ranking-Kriterien ausrichten, Forscher, die publikationsstrategisch denken, Städte, die „Ranking-Management“ betreiben, Arbeitnehmer, deren Leistung von undurchsichtigen Algorithmen bewertet wird.
Eine Frage der Haltung
Vielleicht sollten wir uns an John Keating erinnern: Nicht alles, was zählt, kann gezählt werden. Nicht alles, was wertvoll ist, lässt sich in eine Rangfolge pressen. Die Sehnsucht nach einfachen Antworten, nach klaren Hierarchien in einer komplexen Welt ist verständlich. Doch der Preis für diese Vereinfachung ist hoch: Wir opfern Differenzierung, Kontextualität und kritisches Denken auf dem Altar der vermeintlichen Objektivität.
Rankings mögen uns Orientierung versprechen. Doch wahre Orientierung entsteht nicht durch das blinde Vertrauen in Zahlen, sondern durch die Fähigkeit, die Maßstäbe selbst zu hinterfragen – und die Interessen zu erkennen, die sich hinter ihnen verbergen. Es geht nicht darum, auf jede Form des Vergleichs zu verzichten. Es geht darum, die Praktiken des Vergleichens bewusst zu gestalten, ihre Grenzen anzuerkennen und ihre Macht zu begrenzen.
In einer Welt, die zunehmend von Algorithmen regiert wird, brauchen wir mehr denn je die Fähigkeit, das Unvergleichbare zu würdigen, das Nicht-Quantifizierbare zu schätzen und die Komplexität auszuhalten. Das ist keine Absage an Wissenschaft oder Rationalität – es ist im Gegenteil ihre Rettung vor der Reduktion auf bloße Rechenoperationen.
Der Ausstieg der Universität Zürich aus dem THE-Ranking könnte der Beginn einer größeren Bewegung sein. Denn wie Keating seinen Schülern zurief: Wir haben es hier nicht mit Klempnerei zu tun, sondern mit Leben. Und Leben lässt sich nicht in Zahlen fassen – auch wenn die Propheten der Numerokratie uns das weismachen wollen.
Quellen:
Einige Anmerkungen zu Rankings
Warum die Uni Zürich aus einem renommierten Universitäts-Ranking aussteigt
So entscheiden KI und Algorithmen in der Arbeitswelt über Sie
Bürgerrat gegen Fakes: Ein Bürgergutachten für den Bertelsmann-Konzern?
Bertelsmann-Stiftung wegen Krankenhaus-Studie erneut in der Kritik