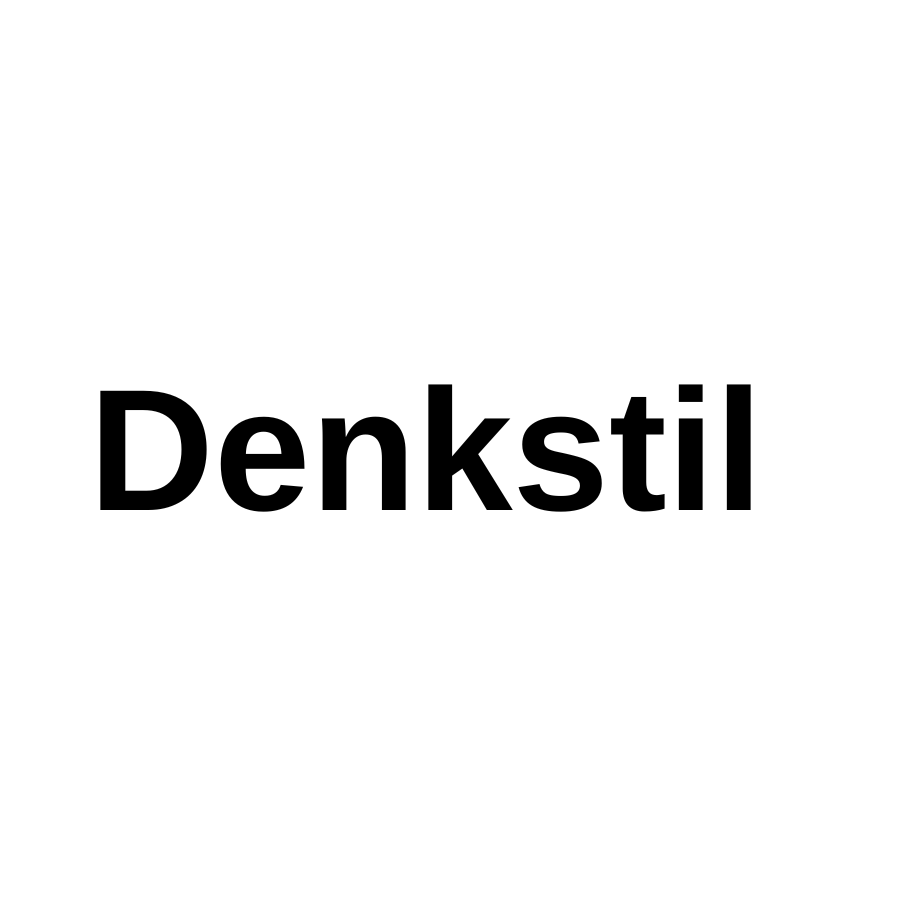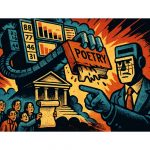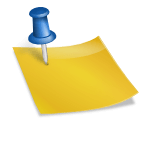In den Bürotürmen der Weimarer Republik entdeckte Siegfried Kracauer eine fundamentale Täuschung: Menschen, die sich für Individuen hielten, waren längst zu austauschbaren Teilen einer Maschinerie geworden. Seine Analyse von 1930 liest sich heute wie eine Prophezeiung unserer eigenen Arbeitswelt.
Es gibt Bücher, die ihre Zeit überdauern, weil sie nicht nur beschreiben, was ist, sondern durchschauen, was sein will und doch nicht ist. Siegfried Kracauers „Die Angestellten“ aus dem Jahr 1930 gehört zu diesen seltenen Werken. In den Büros, Warenhäusern und Verwaltungen der Weimarer Republik beobachtete Kracauer eine neue soziale Figur: den Angestellten, der weder Arbeiter noch Bourgeois war, sondern etwas Drittes, etwas Hybrides – und gerade deshalb zum Schlüssel für das Verständnis der modernen Gesellschaft wurde.
Die Angestellten: Eine Klasse zwischen den Stühlen
Was Kracauer mit ethnographischer Präzision dokumentiert, ist die Geburt einer gesellschaftlichen Schicht, die ihre Existenz auf einem Widerspruch gründet. Die Angestellten tragen die äußeren Insignien bürgerlichen Lebens: Sie beziehen ein Monatsgehalt statt eines Wochenlohns, sie arbeiten mit dem Kopf statt mit den Händen, sie tragen weiße Kragen statt blauer Overalls. All diese Merkmale suggerieren eine Nähe zum Bürgertum, eine Distanz zur Arbeiterschaft, einen Status, der über dem bloßen Proletariat steht.
Doch Kracauer erkennt, dass diese Distinktionen zunehmend hohl sind. Die materielle Basis, die einst bürgerliches Leben ausmachte – ökonomische Unabhängigkeit, Besitz, Gestaltungsmacht – ist für die meisten Angestellten ebenso unerreichbar wie für die Fabrikarbeiter. Was bleibt, ist eine Fassade, ein „mittelständisches“ Selbstverständnis, das auf Traditionsresten ruht und zunehmend zur Maskerade wird. Die Angestellten leben nicht bürgerlich, sie spielen Bürgerlichkeit.
Das falsche Bewusstsein: Distinktion als Selbsttäuschung
Der Begriff des „falschen Bewusstseins“ durchzieht Kracauers Analyse wie ein roter Faden. Gemeint ist damit nicht einfach ein Irrtum oder eine Lüge, sondern eine strukturelle Selbsttäuschung: Die Angestellten halten an sozialen Unterscheidungen fest, die ihnen objektiv nichts nützen – mehr noch, die ihrer eigenen Emanzipation im Weg stehen. Sie grenzen sich nach unten ab, zu den Arbeitern, obwohl ihre Lebenslagen sich zunehmend ähneln. Sie kultivieren einen Individualismus, der längst zur bloßen Geste geworden ist, während die reale Organisation ihrer Arbeit sie zu austauschbaren Funktionsträgern macht.
In den rationalisierten Büros der zwanziger Jahre vollzieht sich eine Taylorisierung der Kopfarbeit, eine Standardisierung und Fragmentierung, die der industriellen Fließbandproduktion in nichts nachsteht. Die Angestellte an der Schreibmaschine ist nicht weniger Rädchen im System als der Arbeiter an der Stanzmaschine. Doch während der Arbeiter seine Klassenlage erkennen und daraus politische Schlüsse ziehen kann, verweigert sich der Angestellte dieser Einsicht. Sein Individualismus ist zur Ideologie geworden, zu einem Glaubenssatz, der die Realität verschleiert statt sie zu erhellen.
Oberflächen der Einzigartigkeit
Was den Angestellten bleibt, sind Fragmente symbolischer Distinktion: die Art, wie man sich kleidet, welches Café man besucht, welche kulturellen Präferenzen man pflegt. Kracauer beschreibt mit feinem Gespür für das Detail, wie sich Identität auf Konsum und Lebensstil verlagert. Der Wunsch nach Einzigartigkeit, nach Unverwechselbarkeit, wird nicht mehr in der Arbeit selbst verwirklicht – dort ist man längst austauschbar geworden –, sondern in der Freizeit, im Privaten, in den kleinen Gesten des guten Geschmacks.
Diese Verlagerung ist folgenreich: Sie privatisiert gesellschaftliche Fragen, sie verwandelt strukturelle Probleme in individuelle Lifestyle-Entscheidungen. Die Angestellten kämpfen nicht für bessere Arbeitsbedingungen oder für politische Teilhabe, sie kämpfen für die Wahrung symbolischer Grenzen, die ihrer realen Lage nicht mehr entsprechen.
Die Aktualität einer alten Diagnose
Wer Kracauers Analyse heute liest, wird von der Aktualität dieser Beobachtungen überrascht sein. Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts inszeniert sich gerne als Gegenentwurf zur Vergangenheit: flache Hierarchien statt steiler Pyramiden, Selbstorganisation statt Command-and-Control, agile Teams statt starrer Abteilungen. Die Rhetorik der „New Work“ verspricht Autonomie, Sinnstiftung, die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben.
Doch unter der Oberfläche dieser Versprechen lauern ähnliche Mechanismen wie zu Kracauers Zeiten. Die Digitalisierung hat die Standardisierung und Kontrolle von Arbeit nicht aufgehoben, sondern verfeinert. Algorithmen überwachen Produktivität mit einer Präzision, von der der Taylorismus nur träumen konnte. Die Flexibilisierung der Arbeitswelt – das Homeoffice, die projektbasierte Beschäftigung, die ständige Erreichbarkeit – hat die Grenzen zwischen Arbeit und Leben nicht aufgelöst zugunsten größerer Freiheit, sondern oft zugunsten totaler Verfügbarkeit.
Und auch das falsche Bewusstsein hat sich transformiert, nicht verschwunden. Die heutigen „Wissensarbeiter“ pflegen ihre eigenen Formen symbolischer Distinktion: die richtige Start-up-Kultur, die korrekten politischen Haltungen, die angesagte Konsumethik. Man arbeitet nicht mehr nur für Geld, man arbeitet für „Purpose“, für Sinn – als ob die Sinnfrage die Machtfrage ersetzen könnte. Man inszeniert sich als kreativ, einzigartig, unersetzlich, während die Plattformökonomie täglich demonstriert, wie austauschbar selbst hochqualifizierte Arbeit geworden ist.
Zwischen Schein und Sein
Was Kracauers Analyse so wertvoll macht, ist ihre schonungslose Präzision in der Diagnose des Widerspruchs zwischen Selbstbild und Realität. Die Angestellten seiner Zeit – und vielleicht auch die unseren – leben in einer permanenten Spannung zwischen dem, was sie zu sein glauben, und dem, was sie objektiv sind. Sie halten an Formen der Identitätsstiftung fest, die ihrer tatsächlichen gesellschaftlichen Position nicht mehr entsprechen.
Diese Spannung ist nicht nur individuell schmerzhaft, sie hat auch politische Konsequenzen. Ein falsches Bewusstsein der eigenen Lage erschwert Solidarität, verhindert kollektives Handeln, fragmentiert mögliche Gegenmacht. Wenn jeder sich für ein Individuum hält, das durch eigene Leistung aufsteigt oder fällt, wenn jeder die eigene Prekarität als persönliches Versagen deutet statt als strukturelles Problem – dann fehlt die Grundlage für gesellschaftliche Veränderung.
Ein Spiegel der Gegenwart
Kracauers „Die Angestellten“ ist kein historisches Dokument, das man ehrfürchtig ins Archiv stellt. Es ist ein Spiegel, der uns unbequeme Fragen stellt: Wie viel von unserer eigenen Arbeitswelt beruht auf ähnlichen Fassaden? Wie viel von dem, was uns als Fortschritt verkauft wird, ist bloße Umdekorierung alter Herrschaftsformen? Und vor allem: Wie viel von unserem eigenen Selbstverständnis als autonome, selbstbestimmte Individuen ist tatsächlich Ausdruck realer Gestaltungsmacht – und wie viel nur die neueste Version jener „mittelständischen Lebensauffassung“, die Kracauer schon 1930 als Illusion durchschaute?
Die Fragen bleiben offen. Das ist vielleicht die größte Stärke dieses schmalen, unprätentiösen Buches: Es gibt keine fertigen Antworten, es öffnet nur die Augen. Und manchmal ist das Sehen-Können schon der erste Schritt zur Veränderung.