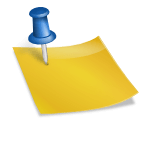Über das Wesen des Geldes wird sei langer Zeit intensiv geforscht. Neben Ökonomen beschäftigen sich mit dieser Frage auch die Soziologen. Einen größeren Bekanntheitsgrad erlangte die Philosophie des Geldes von Georg Simmel. Für den Systemtheoretiker Niklas Luhmann handelt es sich bei Geld um Zahlungsversprechen. Für Aaron Sahr (Bild) schaffen Zahlungsversprechen ein Beziehungsgeflecht, das Wirtschaft und Gesellschaft zusammenhält. Im Gespräch erläutert Aaron Sahr, welche Schlüsse die Diagnose des Beziehungsgeflechts des Geldes auf das
heutige Bankwesen zulässt, wie er die aktuelle Diskussion um Bitcoin und Fintech bewertet und wo er noch weiteren Forschungsbedarf sieht. Der Soziologe und Philosoph Aaron Sahr arbeitet am Hamburger Institut für Sozialforschung. Daneben lehrt er an der Leuphana Universität Lüneburg. In seinem aktuellen Buch Das Versprechen des Geldes. Eine Praxistheorie des Kredits beschäftigt sich Sahr mit den Auswirkungen der Geldschöpfung durch die Banken auf Wirtschaft und Gesellschaft.
Herr Dr. Sahr, mit welchen Fragen beschäftigen Sie sich bei Ihren Forschungen?
Bisher habe ich mich vor allem im Feld der Soziologie des Geldes engagiert. Dazu gehört, dass man sich die Transformationen vergegenwärtigt, die die Institutionen des Geldsystems in den letzten Jahrzehnten durchlaufen haben. Dazu gehört aber auch der Prozess der Finanzialisierung – also der Bedeutungsgewinn von Finanzmärkten für die Gesamtheit ökonomischer Wertschöpfungsprozesse – und dazu gehören schließlich auch Fragen der Verteilung, also die Veränderung von Chancen, Geld einzunehmen und anzusparen. Dieser Zusammenhang von Geldsoziologie und Ungleichheitsforschung ist dabei ein jüngeres Projekt. Und so haben mich die erwähnten Veränderungen zunächst vor allem im Hinblick auf ihre geldtheoretischen Konsequenzen interessiert.
Was macht die Geldtheorie so interessant; wo setzen Sie an?
In der Soziologie findet zurzeit ein Umdenken statt: man hat sich, ganz so, wie es die Ökonomik vorgelebt hat, lange Zeit vor allem für die Funktion von Geld als einem Tauschmittel, Wertspeicher usw. interessiert. Man fand es rätselhaft, warum eigentlich stoffwertlose Dinge wie Papierscheine so wertvoll und damit so funktional werden konnten. Und dann haben sich Soziologinnen und Soziologen die Köpfe darüber zerbrochen, was es eigentlich mit Gesellschaften macht, wenn immer mehr Interaktionen durch ein solch funktionales Medium vermittelt werden. Diese Tradition hat Unmengen spannender Einsichten zutage gefördert und dennoch etwas übersehen, was derzeit immer mehr Forscherinnen und Forscher beschäftigt. Inspiriert von sogenannten heterodoxen ökonomischen Theorien wird heute die Tatsache in den Mittelpunkt der Geldsoziologie gerückt, dass Guthaben aus Schuldverhältnissen besteht. Man geht also von Giralgeld – ein Zahlungsversprechen einer Bank – als Referenz des Geldbegriffs, also Eckpfeiler der Geldtheorie aus. Und nicht mehr von wertvollen Dingen, die man sich wie Sachwerte vorgestellt hat.
Wenn man nun anfängt, über Guthaben als Schuldbeziehung nachzudenken, dann ändert sich die Vorstellung von dem, was soziologisch mit dem Begriff „Geld“ bezeichnet wird. Die Zahlungsversprechen der Banken existieren als buchhalterische Artefakte, die durch die Zahlungsversprechen anderer überhaupt erst möglich werden. Das mag Ihnen nun trivial vorkommen, aber man ruft dann eben mit einer Geldtheorie kein funktionales Medium mehr auf, auch keine rein addierte Menge an einem besonderen Vermögenstitel, sondern ein Beziehungsgeflecht an Zahlungsversprechen, an dem – je nachdem, von welcher Seite man schaut – Gläubiger wie Schuldner beteiligt sind, egal ob sie gerade zahlen oder nicht zahlen. Man könnte auch sagen: es geht darum, von einem tauschtheoretischen auf einen beziehungstheoretischen Blick auf das Geld umzustellen, von Transaktionen auf Relationen sozusagen. Die Konsequenzen dieser Umstellung weiter zu verstehen (und diese Bemühungen sind keinesfalls auf die Soziologie beschränkt), finde ich hoch spannend.
Folgt daraus, dass man dem „Beziehungsgeflecht“ des Geldes nicht entfliehen kann; also alles – mehr oder weniger – so bleibt wie es ist?
Wer ein Girokonto hat, ist Gläubiger in einem weitverzweigten und hochkomplexen Geflecht aus sich wechselseitig ermöglichenden Zahlungsversprechen. Dieses Geflecht ist ständig in Bewegung und verändert sich. Einerseits haben wir es bei Schulden selbstredend mit terminierten (oder kündbaren) Beziehungen zu tun, die kontinuierlich aufgelöst werden und neu geknüpft werden müssen – indem sich wieder jemand verschuldet. Die Fortsetzbarkeit einer solchen Praxis der Beziehungsknüpfung (Verschuldung) und Beziehungsauflösung (Tilgung einer Schuld) ist also keinesfalls selbstverständlich, sondern sie muss praktisch jeden Abend (etwa durch den Saldenausgleich auf dem Interbankenmarkt) sichergestellt werden. Dass das in der Regel sehr gut funktioniert, ist aus soziologischer Sicht fast schon kurios.
Aber auch langfristig ist das Beziehungsgeflecht dynamisch: wie Zahlungsversprechen ausgestaltet werden, wer sie nachfragt und wem vertraut wird, ändert sich ständig. Man denke nur an die Verdrängung klassischer Bankkonten durch Fonds in den USA, man denke an neue Vertragsformen für Schuldbeziehungen und vieles mehr.
Der Ruf der Banken hat zwar durch die Finanzkrise stark gelitten, dennoch genießen sie bei den Kunden noch immer – wie in Fragen des Datenschutzes ein vergleichsweise hohes Ansehen – wie kommt das?
Hierfür sehe ich drei Gründe: Erstens wird in Diskussionen manchmal der Eindruck erweckt, die Bankenbranche sei in der Finanzkrise von 2008 kollektiv gescheitert. Das stimmt natürlich für die allermeisten Länder und Nutzer nicht. Zwar gab es hier und da Probleme bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, aber im Großen und Ganzen konnten die meisten Kunden weiter auf ihr Konto zugreifen und weiter damit bezahlen. Das Scheitern war eher etwas abstraktes, das woanders, irgendwo auf „den Finanzmärkten“ stattgefunden hat. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber das ist die Regel. Zweitens gibt es Banken schon sehr lange und sie sind wie nur wenig andere Institutionen mit ihrem Handlungsfeld, dem Geld, assoziiert. Eine solche Tradition wird nicht so leicht erschüttert, sie wird ja auch rituell immer wieder erneuert. Ich erinnere mich beispielsweise noch sehr gut an die Eröffnung meines ersten „Bankkontos“ – eine Art Spielkonto der Berliner Sparkasse, mit Comicfiguren dekoriert. Drittens schließlich gibt es eine strukturelle Dimension: es gibt keine wirkliche Alternative zu Banken. Man kann nur bedingt auf Bargeld umsteigen und auch dann hätte man nur Geld in einer Hand, hinter dem das Versprechen einer Bank steht. Auch würde der Vermieter zum Monatsanfang weiterhin eine Überweisung von einem Bankkonto erwarten, das Gehalt wird auf ein Bankkonto gebucht usw. Ökonomen würden wohl sagen: die Opportunitätskosten für echtes, d.h. handlungsrelevantes Misstrauen gegenüber Banken sind extrem hoch. Aber letztendlich muss man die erste Antwort in den Mittelpunkt stellen: das, was die meisten von ihrer Bank erwarten – Zahlungsverkehr – machen sie einfach sehr gut.
In den letzten Jahren sind zahlreiche Fintech-Startups am Markt erschienen, die damit werben bzw. geworben haben, das Banking zu „disrupten“. Was sagt die soziologische Forschung dazu?
Dass jetzt neue Firmen auftreten, die behaupten, den Zahlungsverkehr besser abwickeln zu können, ist hochinteressant. Manchmal neigen allerdings selbst Soziologinnen und Soziologen dazu, Hypes und schmeichelhaften Selbstbeschreibungen von Szenen oder Branchen auf den Leim zu gehen. Das ist beispielsweise geschehen, als die Dotcom-Blase zu einem neuen „immateriellen“ Kapitalismus, oder der Lifestyle der Kreativwirtschaft zu einem „ästhetischen“ Kapitalismus hochstilisiert wurde. Es ist deswegen wichtig, solche Marketingbegriffe wie „Disruption“ kritisch zu betrachtet. Denn der Begriff stammt ja, soweit ich weiß, selbst aus dem Silicon Valley. Doch auch mit gewisser Vorsicht ist der Effekt, den das Auftreten einiger (ehemaliger) Startups wie Amazon oder Uber auf ihre jeweiligen Branchen hatten, nicht kleinzureden. Hier wurden schon ganze Geschäftsfelder neu geordnet. Bei den Fintechs ist eine vergleichbar nachdrückliche „Disruption“ derzeit eher noch Teil jener kommunikativen Strategien, mit denen um Risikokapital konkurriert wird – und weniger bereits eingetretene Realität. Man muss jetzt genau beobachten, wie die Bankenbranche reagiert. Hier liegt immerhin noch das Kapital, mit dem diese Firmen groß werden oder in bestehende Strukturen integriert werden könnten. Dieser Blog trägt ja nicht unerheblich zu dieser „Beobachtung“ bei.
Einige erkennen in digitalen Währungen wie Bitcoin die Chance, das bestehende Finanzsystem von Grund auf zu ändern und zentrale Instanzen wie Banken sowie unsere bisherigen Währungen überflüssig zu machen – wie realistisch ist dieses Szenario?
Auch hier gilt es, den hochtemperierten Diskurs der early adopter und Technologieenthusiasten mit Vorsicht zu sondieren. Bitcoin selber ist sicherlich ein Lehrbuchbeispiel für Spekulationsblasen. Ich würde die Karriere von Bitcoin deswegen eher im Kontext der ständigen Rekordpreise von Kunstwerken oder der Vermögenspreisinflation insgesamt verorten. Es ist als verlässliches Zahlungsmittel also unbrauchbar. Das scheint mir auch weitgehender Konsens zu sein. Ich will in diesem Zusammenhang zwei andere Aspekte betonen: Die Geschichte von Geldordnungen ist keine Geschichte rationaler Verbesserung ökonomischer Transaktionen. So wurde sie zwar von der ökonomischen Klassik und Neoklassik gerne erzählt, das sehen Historikerinnen und Soziologen aber anders. Der Wandel von Geldsystemen ist immer politisch, er hat mit Machtverhältnissen, Profitmöglichkeiten, staatlichem Finanzierungsbedarf, fiskalischen Regeln (in welcher Währung darf ich Steuern und Strafen bezahlen beispielsweise) und vielem mehr zu tun. Das Argument, Bitcoin sei so fürchterlich praktisch, dass sich die Kosten für Intermediäre wie Banken umgehen ließen, hat historisch betrachtet wenig Gewicht.
Zweitens führen Bitcoin-Enthusiasten neben der hohen Funktionalität gerne die absolute Knappheit dieses Zahlungsmittel als Argument für seine Überlegenheit über herkömmliches Geld an. Immerhin ist die Menge möglicher Bitcoins nicht nur endlich, sondern eindeutig determiniert. Tatsächlich ist es historisch betrachtet doch aber so, dass Knappheit für Zahlungsmittel eher ein Problem als ein Vorteil war. Märkte haben auf einen Mangel immer wieder mit der Generierung von Geldsurrogaten reagiert und auch politische Autoritäten haben, wenn es mit der eigenen Finanzierung problematisch wurde, immer wieder die Knappheit der alten Währung durch eine Reform überwunden. Es wäre sicherlich zu stark vereinfacht zu sagen, dass Zahlungssysteme immer dann scheitern, wenn Kapitalisten oder Fürsten in solche Zahlungsengpässe geraten, die nur noch durch eine Geldreform zu beheben sind – aber ganz falsch ist es auch nicht. Für Bitcoin als neues Geld spricht also womöglich gar nicht so viel, wie man manchmal meint. Das ändert im Übrigen nichts daran, dass die Technologie hinter Bitcoin und Co, die Blockchain (oder allgemeiner: Distributed Ledger Technology), faszinierend ist, auch und gerade aus soziologischer Sicht. Nicht zuletzt, weil wirkmächtige Akteure wie die Zentralbanken beginnen, damit zu experimentieren. Hier gilt es für die Soziologie, aufmerksam zu sein, ohne die hyperliberalen Träume der Bitcoin-Nutzer unreflektiert zu replizieren.
Wird der Einfluss technologischer Entwicklungen auf die Gesellschaft überschätzt?
Ich würde es anders formulieren: es gibt einfach keine rein technologischen Entwicklungen. Das mag man jetzt für trivial halten, ist aber eine wichtige Prämisse. Dass irgendeine Erfindung beispielsweise eine technische Lösung für ein bestimmtes, durch eine Theorie definiertes Problem ist (etwa: Effizienz), bewirkt noch nicht, dass die neue Technologie sich durchsetzt. Das hat vielmehr mit kulturellen Mustern, Zufällen und natürlich mit Machtverhältnissen zu tun. Generell sind außerdem die sozialen Strukturen, die Technologie tragen und einbetten, relativ stabil. Es gibt zwar Zweige der Soziologie, die meinen, Technologien wie das Internet, Smartphones oder Podcasts würden ein fundamentales Umdenken erfordern, eine ganz neue Theorie sozialer Zusammenhänge, wenn man so will. Aber das hat mir noch nie eingeleuchtet. Das scheint mir eine These zu sein, die den eindrucksvollen Marketingshows von Apple auf den Leim gegangen ist, bei denen mit viel Tamtam immer wieder Revolutionen auf dem Technologiemarkt verkündet wurden. Am Ende hält der Endverbraucher dann etwas ratlos ein sehr teures Telefon in den Händen, das unter ausbeuterischen Verhältnissen hergestellt wurde und die Apple-Aktionäre wieder ein bisschen reicher gemacht hat. So neu ist das gesellschaftliche Verhältnis dann doch auch nicht, das hinter dem Smartphone steht und durch das Smartphone reproduziert wird. Natürlich übertreibe ich hier: selbstverständlich macht Technik neue Geschäftsformen und Kommunikationsmodi möglich, die für die Soziologie interessant und wichtig sind. Man denke etwa nur an die „Plattformlogik“ der großen Leitunternehmen des Internets. Aber weder determiniert Technologie eine Veränderung sozialer Strukturen, noch kann man vom theoretischen Potential einer Technologie auf ihre gesellschaftliche Karriere schließen. Solche Kausalitäten lassen sich immer erst hinterher unterstellen.
Banken verfügten in der Vergangenheit von allen Wirtschaftsakteuren über den umfangreichsten Datenbestand – das hat sich mit dem Aufkommen der sog. Datenökonomie und durch Internetkonzerne wie Apple, Amazon und Google geändert – welche Folgen könnte das für die Banken haben?
Damit sprechen Sie ein wirklich interessantes Szenario an. Es ist von großem Vorteil für einen Anbieter von Krediten, viel über die Vorgeschichte eines potentiellen Schuldners zu wissen. Und machen wir uns nichts vor: Mahnungen wegen säumiger Zahlungen landen im E-Mailpostfach von Google, wir suchen nach „Inkasso vermeiden“ in Googles Suchmaschine oder können eine App-Abonnement im Google-Store nicht mehr verlängern – die Möglichkeiten, kreditrelevante Informationen zu sammeln, sind hier grenzenlos. Auch Amazon weiß wahrscheinlich mehr über die Konsum- und Preisentwicklung ganzer Volkswirtschaften als manch institutioneller Beobachter und könnte dementsprechende Anlagetipps geben. Seit die Banken in globaler Konkurrenz auf Renditemargen zielen, die sich durch lokale Finanzierungen (für die sie lange als einzige die Expertise hatten) nicht mehr generieren lassen, haben sie tatsächlich ein Problem. Vor der Finanzkrise von 2008 haben die amerikanischen Banken das gelöst, indem sie einfach jedem Kredit gegeben haben und ihre Gewinne durch Verbriefung, also den Verkauf undurchsichtiger Pakete, erwirtschaftet haben. Solche Ausweichstrategien sind auch, aber sicher nicht nur, Ausdruck dieser Problematik. Aber von einer Ablösung der Banken muss man nicht ausgehen. In den Zentren der Weltwirtschaft haben wir es ja mit komplexen Firmennetzwerken zu tun, die nicht entweder eine Bank sind oder nicht, sondern mit Konglomeraten, die sowohl aus Banken als auch aus Nichtbanken bestehen. Es könnte also sein, dass Banken, die Teil der Netzwerke der Datenriesen sind, Geschäftsfelder bedienen können, die anderen Banken nicht mehr lukrativ verwerten können. Ob deswegen das Hauptquartier des Finanzkapitalismus von New York und der City of London in das Silicon Valley umzieht, bleibt abzuwarten.
Besteht auch in Zukunft noch Bedarf an Organisationen, die uns die Arbeit abnehmen, wie z.B. bei der Suche geeigneter Anlageformen und Kredite sowie bei der Verwaltung unserer (digitalen) Vermögenswerte?
Es gibt jedenfalls wenig Grund, vom Gegenteil auszugehen. Mir ist klar, dass die Enthusiasten der Distributed Ledger Technology von einer „dezentralen“ Gesellschaft träumen – einer Gesellschaft, in der Interaktionen zwischen Einzelpersonen ohne Mittelsmänner durchführbar sind. Also etwa Zahlungen oder Kredite ohne Banken, oder auch ohne Notare oder gar Anwälte (dank smart contracts). Und diese Phantasie ist nicht auf die Finanzwelt beschränkt, hier gehört etwa auch die Vorstellung einer digital vermittelten liquid democracy dazu, die dann und wann zur Alternative des Parlamentarismus stilisiert wird. Mein Problem damit ist: Soziologisch betrachtet gibt es Institutionen und Organisationen nicht nur, weil ihr Einsatz im strengen Sinne ökonomische Kosten reduziert. Wir schließen beispielsweise nicht nur deswegen Versicherungen ab, weil wir glauben, am Ende mehr rauszubekommen als wir eingezahlt haben. Genauso wenig bucht man bei seinem Telefon- oder Unterhaltungsanbieter Flatrates, weil Pauschalbeträge günstiger wären als der Einzelkauf. Ich will darauf hinaus, dass es extrem attraktiv ist, sich nicht um alles selbst kümmern zu müssen. Zahlungen beruhigen, ganz unabhängig von einem messbaren Gegenwert. Es geht gerade darum, den Kopf frei zu haben von solchen Kalkülen. Es ist beispielsweise einfach angenehm zu unterstellen, dass sich jemand darum kümmert, dass alles seinen gewohnten Gang geht. Zeitbudgets und Motivation, sich mit allem auseinanderzusetzen, sind begrenzt, Intermediäre verschaffen Abhilfe und können gleichzeitig (dann und wann) zur Verantwortung gezogen werden, wenn etwas schief läuft – oder man hat wenigstens jemanden, auf den man wütend sein kann. Das ist sicherlich nur ein Aspekt einer allgemeinen Binsenweisheit der Soziologie: Gesellschaften bestehen nicht nur aus Individuen – und daran wird auch die Blockchain nichts ändern.
Wo sehen Sie für die nächsten Jahre in Ihrem Fach den größten Forschungsbedarf?
Mit Antworten auf solche Fragen macht man sich als Nachwuchswissenschaftler schnell unbeliebt. Ich will aus meiner Warte dennoch ein paar Stichworte in den Raum werfen. Wir müssen in der Soziologie erstens unsere Theorien über Makroökonomie und das Verhältnis von Wirtschaft, Gesellschaft und Staatlichkeit unter einer beziehungstheoretischen Perspektive noch einmal sondieren. Also einer Perspektive, wie ich sie eingangs skizziert habe, die von Verschuldung und Verschuldungsauflösung als basalem Prozess ökonomischer Zusammenhänge ausgeht – nicht von Kapitalakkumulation oder Markttausch. Hier müssen wir, meine ich, noch stärker den Dialog mit sogenannten heterodoxen ökonomischen Theorien suchen, ohne sie unkritisch zu übernehmen. Zweitens gilt es, bei den vielfältigen Experimenten alternativer Währungen und Zahlungssysteme am Ball zu bleiben und diese Entwicklungen vor dem Hintergrund einer soliden Geldtheorie zu reflektieren. Drittens fände ich eine Intensivierung historischer Soziologie des Banken- und Finanzsystems spannend, die vor allem nach den (rechtlichen, technischen, politischen und sozialen) Grundlagen privater Geldschöpfung fragt. Mir scheint – aber ich sage das hier alles wie gesagt aus meiner eingeschränkten Perspektive – hier noch Forschungsbedarf zu bestehen. Viertens scheinen mir Geldtheorie und Geldschöpfung in populären Ansätzen der Ungleichheitsforschung noch nicht hinreichend integriert zu sein. Ich habe das in einer kleinen Schrift bereits etwas ausgeführt und wenn man etwas publiziert hofft man natürlich immer auf eine Debatte. Fünftens schließlich gilt es, die Rolle von Geld und Geldschöpfung für die „Resilienz des Finanzkapitalismus“ explizit zum Thema zu machen – so zumindest formuliert es ein Forschungsnetzwerk, zu dem ich eingeladen wurde und auf dass ich mir an dieser Stelle hinzuweisen erlaube (http://www.politicsofmoney.org/).
Herr Dr. Sahr, vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview erschien zuerst auf Bankstil