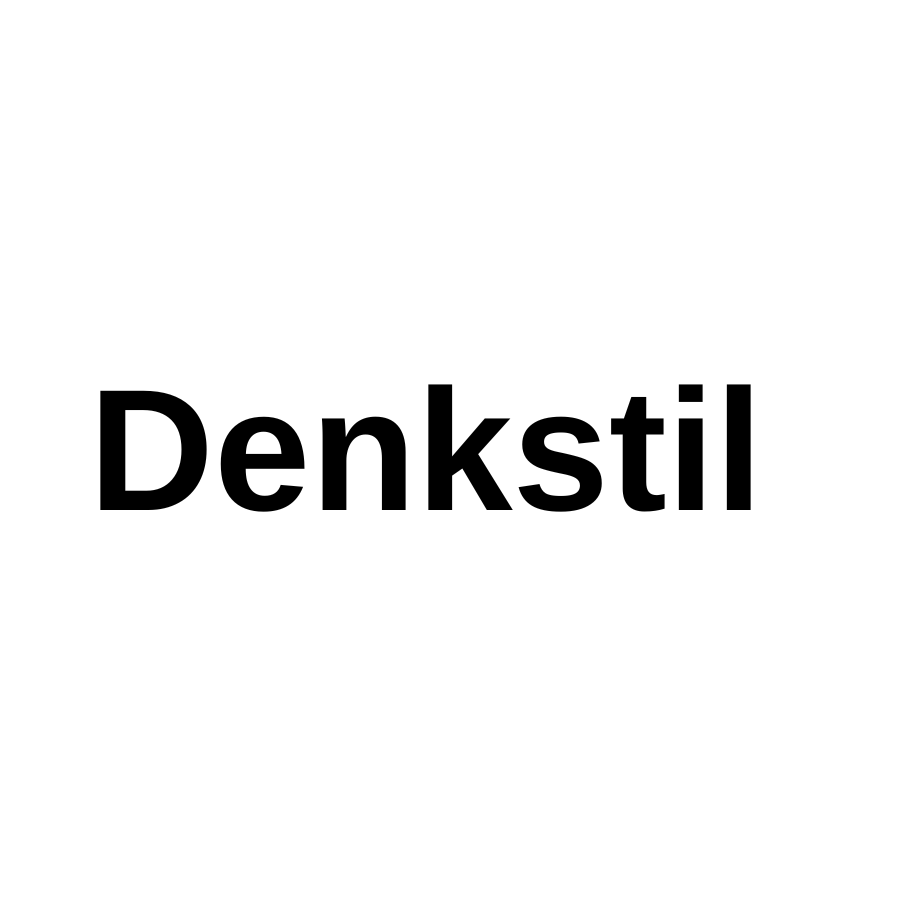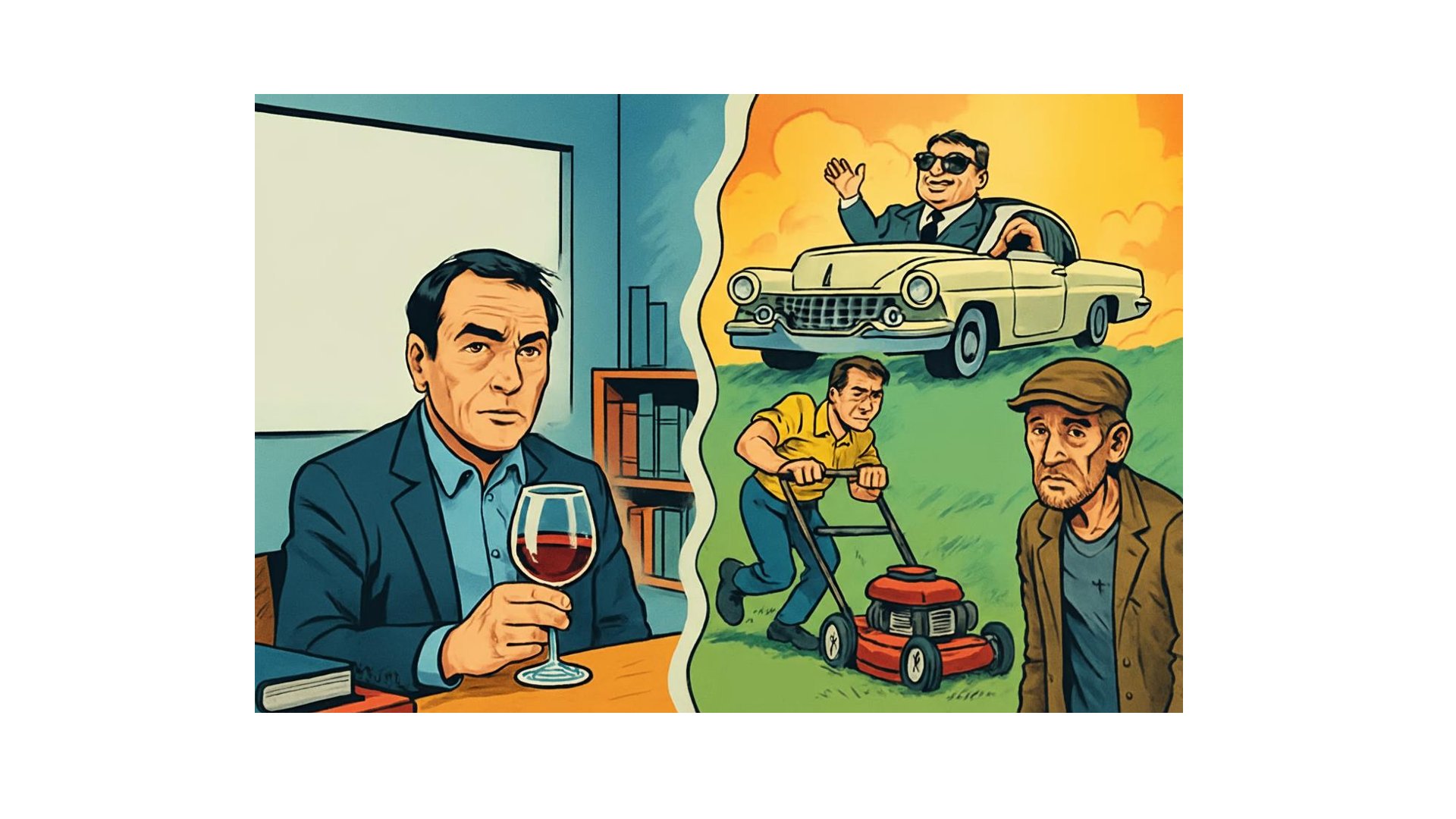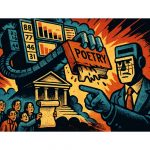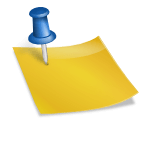Paul Fussells „Cashmere, Cocktail, Cadillac“ und Pierre Bourdieus „Die feinen Unterschiede“ beschreiben dasselbe Phänomen: wie Geschmack, Stil und Konsum als soziale Marker wirken. Doch während Bourdieu Gesellschaft als strukturiertes Feld objektiver Machtverhältnisse denkt, verwandelt Fussell sie in eine glänzende Satire über menschliche Eitelkeit.
Paul Fussells „Cashmere, Cocktail, Cadillac“ (Originaltitel: „Class – A Guide Through the American Status System“) ist eine brillante, satirische Anatomie der amerikanischen Klassengesellschaft. In lakonischem, oft beißendem Ton beschreibt Fussell, wie Kleidung, Autos, Architektur, Essen und Freizeitgestaltung zu Signalen sozialer Zugehörigkeit werden. Sein Blick ist scharf, seine Beobachtungen pointiert – doch sein Zugang ist literarisch, nicht systematisch.
Hier liegt der entscheidende Unterschied zu Pierre Bourdieu, dessen monumentales Werk „La Distinction“ („Die feinen Unterschiede“) fast zeitgleich entstand. Beide Autoren untersuchen, wie Geschmack als soziales Differenzierungsmittel funktioniert. Doch wo Bourdieu die verborgenen Mechanismen kulturellen Kapitals mit wissenschaftlicher Strenge seziert, entlarvt Fussell sie mit Ironie und erzählerischer Leichtigkeit.
Bourdieu beschreibt soziale Klassen als Felder von Macht und Habitus – reproduzierte Strukturen, in denen sich soziale Herkunft, Bildung und ökonomische Ressourcen wechselseitig verstärken. Geschmack, so seine These, ist nie „natürlich“, sondern ein soziales Produkt: Ausdruck der Position im gesellschaftlichen Raum. Ein Glas Bordeaux, eine Vorliebe für Bach oder das Interesse an zeitgenössischer Kunst – all das ist weniger individuelle Präferenz als kulturell codierte Selbstdarstellung.
Fussell hingegen interessiert sich weniger für diese tiefen Strukturen als für ihre sichtbaren Masken. Sein „Guide through the American Status System“ ist ein Handbuch der Gesten, Stile und Fetische einer Gesellschaft, die vorgibt, klassenlos zu sein – und gerade deshalb umso obsessiver auf Zeichen der Zugehörigkeit achtet. Wo Bourdieu soziologische Diagramme zeichnet, schreibt Fussell Gesellschaftssatire. Seine Typologie der amerikanischen Klassen – von den „Proles“ über die „Middle Class“ bis zu den „Top-Out-of-Sights“ – liest sich wie ein ethnografischer Reisebericht durch die Stammesrituale des Konsums.
Beide Autoren teilen jedoch eine zentrale Einsicht: Status manifestiert sich nicht im Einkommen allein, sondern im symbolischen Kapital – in der Beherrschung jener kulturellen Codes, die als „natürlicher Geschmack“ erscheinen. In dieser Hinsicht ist Fussell der essayistische Bruder Bourdieus: weniger akademisch, aber nicht weniger treffsicher. Seine Ironie ist zugleich Erkenntnisinstrument – ein Spiegel, in dem die soziale Selbsttäuschung sichtbar wird.
So ergänzen sich die beiden Perspektiven auf faszinierende Weise:
- Bourdieu liefert die Theorie der sozialen Reproduktion, die erklärt, warum Klassengrenzen bestehen bleiben.
- Fussell liefert die Erzählung, die zeigt, wie Menschen diese Grenzen performen – oft unbewusst, immer komisch.
Beide Werke sind Momentaufnahmen einer Moderne, die sich über Gleichheit definiert, aber in Wahrheit von subtilen Formen der Distinktion lebt. Der Unterschied liegt im Ton: Bourdieus Analyse will befreien, Fussells Satire entlarven. Gemeinsam jedoch führen sie zu derselben Erkenntnis – dass in jeder Gesellschaft, die sich als offen begreift, der Wunsch, „besser“ zu sein, nie verschwindet.