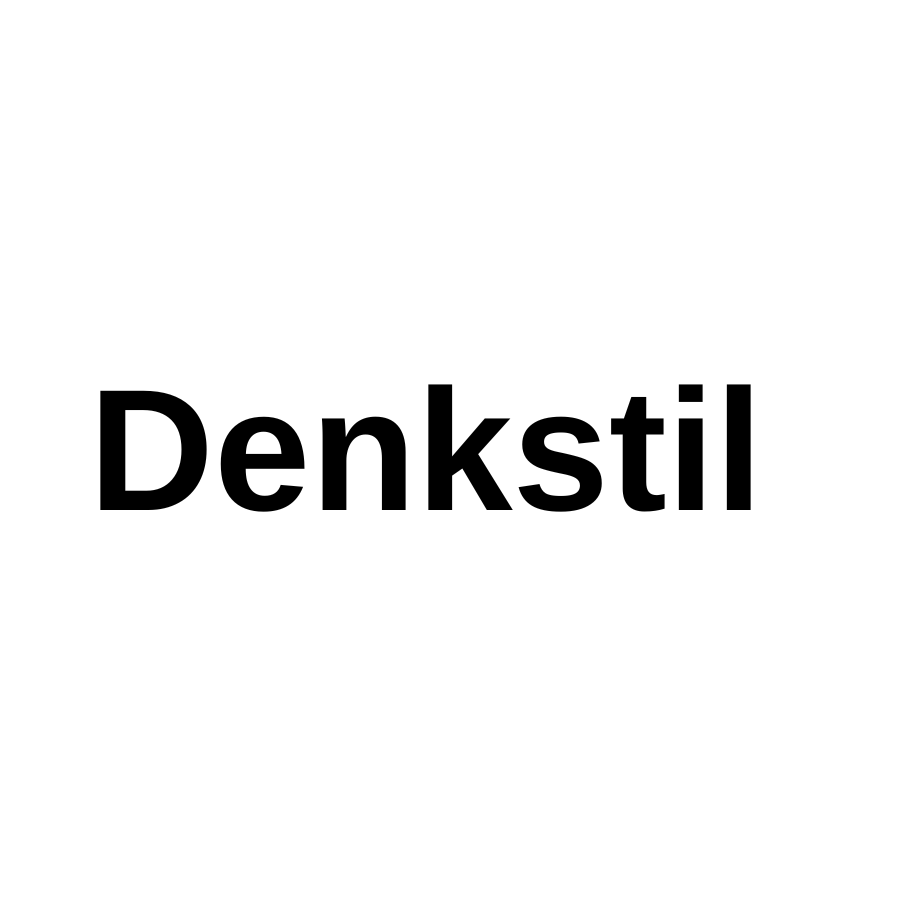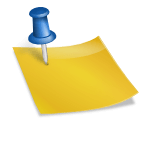Als Friedrich Eduard Beneke 1822 in Berlin das Vorlesungsverbot erteilt wurde, offenbarte sich ein Konflikt, der weit über persönliche Rivalitäten hinausging: der Kampf zwischen erfahrungsbasierter Psychologie und spekulativem Idealismus, zwischen empirischer Methode und absoluter Vernunft. Beneke, heute nahezu vergessen, wurde zum prominentesten Opfer jener akademischen Macht, die Georg Wilhelm Friedrich Hegel in der preußischen Hauptstadt ausübte.
Zwei unvereinbare Welten
In der philosophischen Landschaft des frühen 19. Jahrhunderts markierten Hegel und Beneke nicht nur unterschiedliche Positionen – sie repräsentierten grundsätzlich verschiedene Auffassungen davon, was Philosophie sein sollte und wie sie zu betreiben sei. Während Hegel die Wirklichkeit aus der Vernunft und dem absoluten Geist ableitete und mit seiner spekulativen Dialektik die deutsche Universitätsphilosophie dominierte, verfolgte Beneke (1798–1854) einen radikal entgegengesetzten Weg.
Beneke orientierte sich an den kritischen und empirischen Traditionen Kants, Fries‘ und Herbarts. Seine Vision war eine Philosophie, die sich auf Erfahrung und Psychologie gründete – eine Wissenschaft, die beobachtbare Phänomene des Bewusstseins zum Ausgangspunkt nahm, statt in den Höhen abstrakter Systeme zu schweben. Für Beneke war Hegels Methode eine Form der Realitätsverweigerung: Die spekulative Ableitung der Wirklichkeit aus begrifflichen Notwendigkeiten ignoriere die tatsächliche Beschaffenheit der Erfahrung und nehme den Realismus nicht ernst.
Was Beneke anstrebte, war nichts Geringeres als eine Reform der Philosophie in Richtung Erfahrungswissenschaft. In seinen Augen sollte die Philosophie nicht länger ein geschlossenes System metaphysischer Spekulation sein, sondern eine offene, an der Empirie orientierte Untersuchung psychologischer und erkenntnistheoretischer Prozesse. Diese Forderung stellte ihn in direkten Gegensatz zur hegelschen Schule, für die gerade die Ableitung aus dem Absoluten das Wesen echter Philosophie ausmachte.
Der institutionelle Konflikt
Der philosophische Gegensatz hätte eine akademische Debatte bleiben können – doch in Berlin, wo Hegel als Professor eine mächtige Position innehatte und großen Einfluss auf Universität und Ministerium ausübte, wurde daraus ein existenzieller Kampf. Beneke gelang es zunächst, trotz des Widerstands hegelscher Kreise, als Privatdozent Fuß zu fassen. Seine Vorlesungen erfreuten sich erheblicher Beliebtheit; er sammelte beachtliche Hörerschaften, die offenbar nach einer Alternative zum allgegenwärtigen Hegelianismus suchten.
Doch der Erfolg währte nicht lange. 1822 wurde Beneke ein Vorlesungsverbot erteilt – eine drastische Maßnahme, die auf ministeriellen und hegelschen Druck zurückging. Die offizielle Begründung offenbarte die ideologische Verengung der damaligen preußischen Universitätsphilosophie in aller Deutlichkeit: Eine Philosophie, die nicht alles vom Absoluten herleite, könne nicht als Philosophie anerkannt werden. Was sich als definitorische Klarstellung gab, war in Wahrheit eine Exkommunikation: Wer nicht hegelianisch philosophierte, philosophierte nicht.
Beneke wurde so zum prominentesten „Hegel-Opfer“ in der akademischen Szene Berlins. Sein Fall illustriert exemplarisch die Mechanismen akademischer Machtausübung im Zeitalter der deutschen Idealismus-Herrschaft. Es ging nicht um die besseren Argumente, sondern um institutionelle Kontrolle und die Definitionshoheit darüber, was als legitime Philosophie zu gelten hatte.
Ein Konflikt ohne Versöhnung
Die Beziehung zwischen Beneke und Hegel – wenn man überhaupt von einer Beziehung sprechen kann – war von Anfang an durch wissenschaftlichen Gegensatz und direkte institutionelle Konkurrenz geprägt. Von Freundschaft oder kollegialer Auseinandersetzung konnte keine Rede sein. Stattdessen dominierte ein Philosophiestreit, der sich zu akademischer Ausgrenzung verdichtete und in dem die hegelschen Kreise ihre institutionelle Überlegenheit nutzten, um abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen.
Benekes Schicksal wirft ein Schlaglicht auf die Schattenseiten jener Epoche, die oft als Blütezeit deutscher Philosophie gefeiert wird. Es zeigt, wie philosophische Systeme zu Herrschaftsinstrumenten werden können und wie akademische Institutionen genutzt werden, um intellektuelle Monopole zu sichern. Die Frage, ob eine auf Erfahrung gegründete Psychologie oder ein spekulativer Idealismus der richtige Weg sei, wurde nicht im freien Diskurs entschieden, sondern durch Lehrverbote.
Heute ist Beneke weitgehend vergessen, während Hegel zu den Klassikern der Philosophiegeschichte zählt. Doch die Fragen, die Beneke aufwarf – nach dem Verhältnis von Spekulation und Empirie, von System und Erfahrung, von philosophischer Autorität und wissenschaftlicher Offenheit – haben nichts von ihrer Aktualität verloren.
Quellen:
Geschichte des Neukantianismus
FRIEDRICH EDUARD BENEKE. Kant und die philosophische Aufgabe unserer Zeit