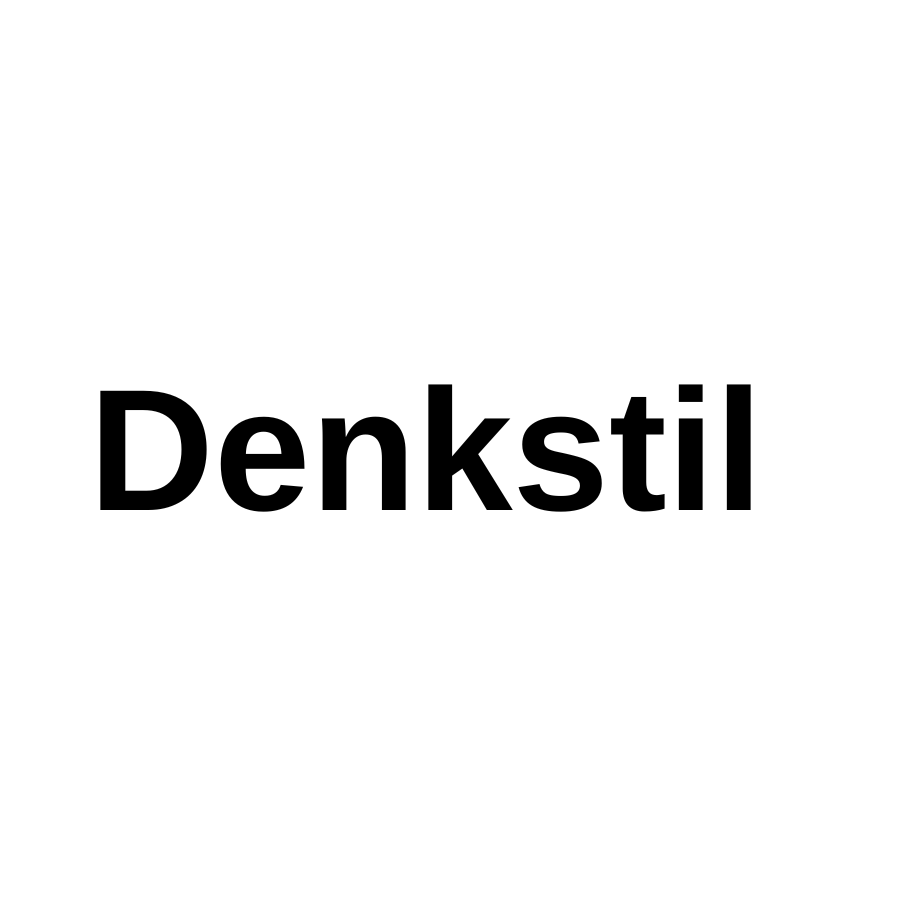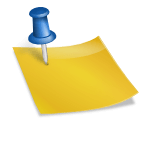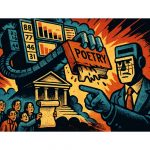Leor Zmigrods neurowissenschaftlicher Ansatz verspricht, Ideologien im Gehirn zu verorten. Doch die methodischen Grenzen der Bildgebungsverfahren und die epistemologische Naivität neuroreduktionistischer Erklärungen enthüllen ein bekanntes Muster: Wo komplexe soziale Phänomene auf molekulare Strukturen reduziert werden, entsteht weniger Wissenschaft als Marketing.
Die Versuchung ist groß. Leor Zmigrod verbindet in ihrem Buch „Das ideologische Gehirn“ Neurobiologie mit Politikwissenschaft, taucht in Molekularbiologie und Philosophiegeschichte ein und verspricht empirische Erkenntnisse darüber, wie Ideologien nicht nur unser Denken, sondern auch unser Gehirn und unsere biologische Struktur verändern. Mit dem Alternative Use Test und dem Wisconsin Card Sorting Test – zwei einfach anmutenden kognitiven Verfahren – will sie nachweisen, welche unterschiedlichen neuronalen Prozesse in rigide und flexibel denkenden Gehirnen ablaufen und wie diese mit ideologischem Denken korrelieren. Das klingt nach wissenschaftlichem Durchbruch, nach der lange gesuchten materiellen Grundlage für etwas so Flüchtiges wie politische Überzeugungen. Doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich ein methodisches und epistemologisches Problem, das weit über dieses einzelne Werk hinausweist und die Grenzen neurowissenschaftlicher Welterklärungsansprüche markiert.
Die zentrale Behauptung, dass „ideologische Überzeugungen“ im Gehirn nicht nur entstehen, sondern auch „sichtbar gemacht“ werden können, beruht auf bildgebenden Verfahren und deren statistischer Auswertung. Was dabei gemessen wird, sind jedoch keine Ideologien selbst, sondern neuronale Aktivitätsmuster, die mit bestimmten Denk- und Verhaltensweisen korrelieren. Zmigrod ist sich dessen bewusst – es sind „nicht die Ideologien selbst, die sichtbar werden, sondern die Gehirnaktivitäten, die mit ideologischem Denken, unabhängig vom jeweiligen Inhalt der Ideologie, einhergehen“. Doch diese methodische Klarstellung wird durch die Buchmetapher vom „ideologischen Gehirn“ wieder eingeebnet.
Die Interpretation dieser Korrelationen ist theoriegeleitet und muss durch psychologische und soziologische Modelle ergänzt werden – sie ergibt sich nicht aus den Daten selbst.
Hier beginnt bereits die methodische Gratwanderung: Bildgebende Verfahren liefern keine Bilder von subjektiven Überzeugungen, sondern von physischen Prozessen, deren Bedeutung erst durch Interpretation erschlossen werden muss. Diese Interpretationen sind, wie Hans Sandkühler formuliert, an Überzeugungen, Denkstile und Wissenskulturen gebunden – also selbst Teil jener ideologischen Strukturen, die sie zu objektivieren vorgeben. Wenn Zmigrod erklärt, „die Grenze zwischen Geist und Gehirn bewusst aufzuheben“ und feststellt, „dass Geist gleich Biologie ist“, dann klingt das nicht nur reduktionistisch, sondern ist es auch. Die fundamentale Differenz zwischen dem Gehirn als physischem Organ und dem Erleben als subjektiver Erfahrung wird hier kategorial eingeebnet.
Die Selbstreferentialität neurowissenschaftlicher Tatsachenproduktion
Hans Sandkühler hat in seiner „Kritik der Repräsentation“ das methodische Vorgehen der fMRT in der Hirnforschung präzise analysiert. Seine Beobachtung ist fundamental: In neurowissenschaftlichen Experimenten werden nicht mentale repräsentationale Leistungen gemessen, sondern physische Prozesse eines neurobiologischen Systems. Diese Prozesse werden aufgrund theoriegeleiteter Hypothesen und mithilfe mathematischer und statistischer Methoden in Bilder und Zeichen transformiert. Die transformierten Daten werden dann als Repräsentationen interpretiert – doch diese Interpretation ergibt sich nicht direkt aus dem experimentell gewonnenen Datenmaterial.
Sandkühlers entscheidende Einsicht: Je nach gewähltem epistemologischem Profil, nach der präferierten Rahmentheorie und dem der Theorie zugehörigen Begriffsschema kommt es – oder kommt es nicht – zu Aussagen über mentale Aktivitäten im Gehirn. Diese Aussagen sind das Ergebnis von Interpretationen, die an Überzeugungen, Denkstile, Denkgemeinschaften und Wissenskulturen gebunden sind. Was als neurowissenschaftliche Tatsache präsentiert wird, ist also selbst theoriegeleitet und sozial bedingt.
Diese Einsicht führt direkt zu Ludwik Fleck, dessen wissenschaftstheoretische Arbeit „Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache“ (1935) den theoretischen Rahmen liefert, um Sandkühlers Beobachtungen zu vertiefen. Flecks Konzepte von Denkstil und Denkkollektiv entlarven die epistemologische Naivität, mit der neurowissenschaftliche Befunde als objektive Tatsachen präsentiert werde
Ein Denkkollektiv, so Fleck, ist die Gemeinschaft von Personen, die im gedanklichen Austausch stehen und einen gemeinsamen Denkstil ausbilden. Dieser Denkstil bestimmt, was überhaupt als wissenschaftliche Frage gilt, welche Methoden als legitim anerkannt werden und wie Beobachtungen interpretiert werden. Wissenschaftliche „Tatsachen“ werden nicht einfach entdeckt, sondern innerhalb dieser kollektiven Denkmuster konstruiert. Was als Wahrheit gilt, ist sozial bedingt und theoriegeladen – nicht objektive Abbildung einer unabhängigen Realität.
Die moderne Neurowissenschaft bildet ein solches Denkkollektiv mit einem hochspezialisierten Denkstil. Dieser Denkstil ist von Bildgebungsverfahren, molekularbiologischen Modellen und der grundlegenden Überzeugung geprägt, komplexe mentale Phänomene seien auf neuronale Prozesse reduzierbar. Die bunten fMRT-Bilder, die wissenschaftliche Autorität ausstrahlen, sind keine neutralen Abbildungen, sondern bereits theoretisch durchdrungene Konstruktionen. Was Forscher in diesen Scans „sehen“, ist durch ihre Erwartungen, ihr theoretisches Framework und die statistischen Modelle vorgeprägt. Die vermeintliche Tatsache eines „ideologischen Gehirns“ ist selbst Produkt dieses Denkstils – sie entsteht durch die spezifische Art, wie das neurowissenschaftliche Denkkollektiv seine Forschungsgegenstände konstruiert, misst und interpretiert.
Die Ironie ist kaum zu übersehen: Forscher, die ideologisches Denken als rigide, binäre Kategorisierung und mangelnde Selbstkritik definieren – als „allergisch gegen das wissenschaftliche Prinzip, dass alles hinterfragt werden sollte“ –, operieren selbst innerhalb eines Denkstils, der sie blind macht für die soziale Konstruiertheit ihrer „Entdeckungen“. Die Suche nach dem ideologischen Gehirn ist selbst ideologisch – im Sinne eines denkstilgebundenen, theoriegeladenen Konstrukts, das die epistemologischen Grenzen seines eigenen Erkenntnisrahmens nicht reflektiert. Was Zmigrod als naturwissenschaftliche Objektivierung subjektiver Überzeugungen präsentiert, ist in Wahrheit die Projektion der Vorannahmen des neurowissenschaftlichen Denkkollektivs auf die Daten. Die Forscher finden das, wonach sie mit ihren theoretischen Vorannahmen und methodischen Werkzeugen suchen – eine zirkuläre Bestätigung ihres eigenen Denkstils.
Dass das ideologische Gehirn „kognitiv rigide, emotional dysreguliert, physiologisch weniger sensibel gegenüber Ungerechtigkeit und Verletzung, neurobiologisch anfällig für süchtig machende Rituale und binäre Kategorien“ sei, klingt zunächst wie eine präzise empirische Beschreibung. Doch was hier als messbare Eigenschaft präsentiert wird, ist das Ergebnis komplexer Interpretationsketten: Von kognitiven Tests über statistische Auswertungen bis zu theoretischen Modellen, die festlegen, was als „Rigidität“, „Dysregulation“ oder „Sensibilität“ gilt. Flecks Wissenschaftstheorie macht deutlich, dass die Frage nicht lautet, ob neurowissenschaftliche Befunde „wahr“ oder „falsch“ sind, sondern unter welchen sozio-epistemischen Bedingungen sie als Tatsachen konstituiert werden. Die Grenzen des neurowissenschaftlichen Denkstils werden besonders dort sichtbar, wo er seine eigene Perspektivität leugnet und universelle Gültigkeit beansprucht.
Die methodischen Defizite der Bildgebungsverfahren
Die methodischen Defizite der funktionellen Magnetresonanztomographie sind seit Jahren bekannt. Felix Hasler hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Überschneidung von Bildgebungsdaten bei Messwiederholungen oft unter 30 Prozent liegt – eine Reproduzierbarkeit, die in kaum einem anderen Wissenschaftszweig akzeptiert würde. Der 2016 entdeckte Softwarefehler in den gängigen Auswertungsprogrammen hat diese Kritik drastisch bestätigt: Falsch-Positiv-Raten von bis zu 70 Prozent statt der angenommenen 5 Prozent bedeuten, dass zehntausende Studien seit den 1990er Jahren Hirnaktivitäten angezeigt haben könnten, die tatsächlich nicht vorhanden waren.
Verantwortlich für diese gravierenden Abweichungen war ein Softwarefehler, der sich vor 15 Jahren im Quellcode eingeschlichen hatte. Die Ursachen liegen in fehlerhaften Annahmen in den statistischen Modellen und einem jahrelangen Bug in der Software 3dClustSim. Die Reaktion der Scientific Community ist bezeichnend: Man fordert mehr Rechenleistung und Data Sharing, nicht aber eine grundsätzliche Reflexion darüber, ob und inwieweit bildgebende Verfahren für die Erforschung komplexer mentaler Prozesse überhaupt geeignet sind. Keine Rede davon, so die Kritik, ob bildgebende Verfahren für die Hirnforschung methodisch angemessen sind.
Michael Wagner spricht von „Cyber-Phrenologie“ – ein Vergleich, der die historische Dimension des Problems beleuchtet. Der Versuch, Persönlichkeitsmerkmale und komplexe psychische Phänomene in Gehirnregionen zu verankern, ist nicht neu. Solche Ansätze wurden in der Vergangenheit zu Recht kritisiert, weil sie die fundamentale Differenz zwischen dem Gehirn als physischem Organ und dem Erleben als subjektiver Erfahrung einebnen. Diese beiden Ebenen sind nicht einfach aufeinander reduzierbar. Was Zmigrod als neuartige Erkenntnis präsentiert – die neurobiologische Verankerung ideologischen Denkens durch genetische Dispositionen und epigenetische Veränderungen –, ist methodisch gesehen eine Annäherung mit vielen offenen Fragen, keine abgeschlossene wissenschaftliche Erkenntnis.
Die Spannung zwischen Methode und Anspruch ist eklatant: Aus zwei „einfach anmutenden empirischen Versuchsreihen“ – dem Alternative Use Test und dem Wisconsin Card Sorting Test – werden weitreichende Schlussfolgerungen über die molekularbiologische Struktur einzelner Gehirnregionen, über genetische Dispositionen und epigenetische Veränderungen abgeleitet. Die Kette der Interpretationen wird immer länger, die empirische Basis bleibt schmal. Mahir Ozdemir bringt die Problematik auf den Punkt: „Given the giant interest and investments in this technology and the flood of publications revealing countless correlations between the fMRI signals and brain functions, it is astonishing how little we know about the BOLD signal and its accurate interpretation.“
Die autoritäre Persönlichkeit und ihre neurowissenschaftliche Wiedergeburt
Zmigrod knüpft explizit an Else Frenkel-Brunswicks und Theodor W. Adornos Studie über „The Authoritarian Personality“ (1951) an. Diese historische Verbindung ist aufschlussreich, aber auch problematisch. Die Autoritarismusforschung der Nachkriegszeit versuchte, die psychologischen und sozialen Bedingungen zu verstehen, die Menschen für totalitäre Ideologien anfällig machen – eine Frage, die aus der Erfahrung des Nationalsozialismus erwuchs. Frenkel-Brunswick, dem Wiener Kreis des logischen Positivismus verbunden, legte umfangreiche empirische Untersuchungen vor, die den Grundstein für die Studie legten. Doch die theoretische Rahmung blieb sozialwissenschaftlich und psychologisch – es ging um Sozialisation, Erziehungsstile, gesellschaftliche Strukturen.
Zmigrods Ansatz verschiebt diese Fragestellung fundamental: Statt nach den sozialen Bedingungen autoritären Denkens zu fragen, sucht sie nach dessen neurobiologischen Korrelaten. Was bei Frenkel-Brunswick als Ergebnis sozialer Erfahrung verstanden wurde, wird nun als genetische Disposition und molekularbiologische Gehirnstruktur reformuliert. Diese Verschiebung ist mehr als nur eine Ergänzung der Perspektive – sie verändert die Art der Fragestellung grundlegend. Wo Frenkel-Brunswick nach den gesellschaftlichen Bedingungen fragte, die autoritäre Persönlichkeiten hervorbringen, sucht Zmigrod nach den biologischen Markern, die Menschen dafür prädisponieren.
Die politischen Implikationen dieser Verschiebung werden selten diskutiert. Wenn ideologisches Denken primär als biologisches Phänomen verstanden wird, verlagert sich die Verantwortung von sozialen Strukturen auf individuelle Dispositionen. Die Gefahr einer neuen biologischen Determinierung politischer Haltungen ist offensichtlich – auch wenn Zmigrod betont, dass die Verteilung der Anfälligkeit für ideologisches Denken einem Spektrum folgt und nicht festgelegt ist.
Das Marketing der Neurowissenschaften
Der Vergleich zu Antonio Damasio ist aufschlussreich. Auch Damasio hat mit populärwissenschaftlichen Erklärungen zu Moral und Emotion große Aufmerksamkeit erzielt, seine Interpretationen – etwa anhand des Falls Phineas Gage – werden jedoch wissenschaftlich kritisch diskutiert und der medialen Zuspitzung zugeschrieben. Es entsteht ein Muster: Neurowissenschaftliche Befunde werden mit weitreichenden Interpretationen über menschliches Verhalten, Moral oder Politik verknüpft, die deutlich über das hinausgehen, was die Daten tatsächlich hergeben. Der „Neuroglamour“, den die Öffentlichkeit bereitwillig konsumiert, verdeckt die methodischen Unsicherheiten und epistemologischen Grenzen. Das ist nicht per se unwissenschaftlich, aber es ist Marketing.
Mahir Ozdemir formuliert die grundsätzliche Problematik präzise: Der neurobiologische Reduktionismus ersetzt zunehmend seinen genetischen Vorgänger und versucht, alles über uns mittels neuronaler Korrelate zu erklären. Dieser infinite reduktionistische Pfad, so Ozdemir, erlaube möglicherweise nicht den Sprung zum wahren Verstehen dessen, wer wir sind. Manche Aspekte der menschlichen Erfahrung würden sich womöglich für immer entziehen. Diese Skepsis ist nicht wissenschaftsfeindlich, sondern markiert die Grenzen eines Paradigmas, das komplexe soziale und psychische Phänomene auf molekulare Strukturen zu reduzieren versucht.
Ein „ideologisches Gehirn“ im objektiven, wissenschaftlich eindeutigen Sinne existiert nicht. Gehirne zeigen keine klar abgrenzbaren ideologischen Strukturen. Was existiert, sind neuronale Muster, die mit bestimmten Denkweisen assoziiert sein können – doch diese Assoziation ist keine eindeutige Kausalität, und die Interpretation bleibt theorieabhängig und offen für andere Deutungen. Ideologisches Denken ist ein komplexes psychologisches und soziales Phänomen, das durch individuelle Erfahrungen, kulturelle Prägungen und soziale Kontexte geformt wird. Die Neurobiologie kann Korrelate erkennen, aber sie kann das Phänomen nicht erschöpfend erklären.
Das bedeutet nicht, dass neurowissenschaftliche Forschung wertlos wäre. Sie liefert wichtige Hinweise und erweitert unser Verständnis. Doch sie darf nicht den Anspruch erheben, komplexe soziale und mentale Phänomene vollständig zu erklären. Zmigrod leistet einen Beitrag zu einem interdisziplinären Forschungsfeld, aber ihre Aussagen müssen als vorläufig, interpretativ und methodisch begrenzt verstanden werden. Die Fiktion des ideologischen Gehirns ist als Forschungsmetapher nützlich – als naturwissenschaftliche Tatsache ist sie unhaltbar. Eine kritische, epistemologisch reflektierte Wissenschaft erkennt diese Grenze an und vermeidet die Versuchung, empirische Befunde mit weitreichenden Welterklärungen zu überfrachten. Dass Zmigrods Buch auch das Verdienst zukommt, auf die weithin vergessene Forscherin Else Frenkel-Brunswick aufmerksam gemacht zu haben, ändert nichts daran, dass die neurowissenschaftliche Reformulierung der Autoritarismusforschung methodisch und theoretisch auf tönernen Füßen steht.
Quellen:
Die Defizite bildgebender Verfahren am Beispiel der Hirnforschung
Neuro-Hype: Einige Anmerkungen zur Hirnforschung