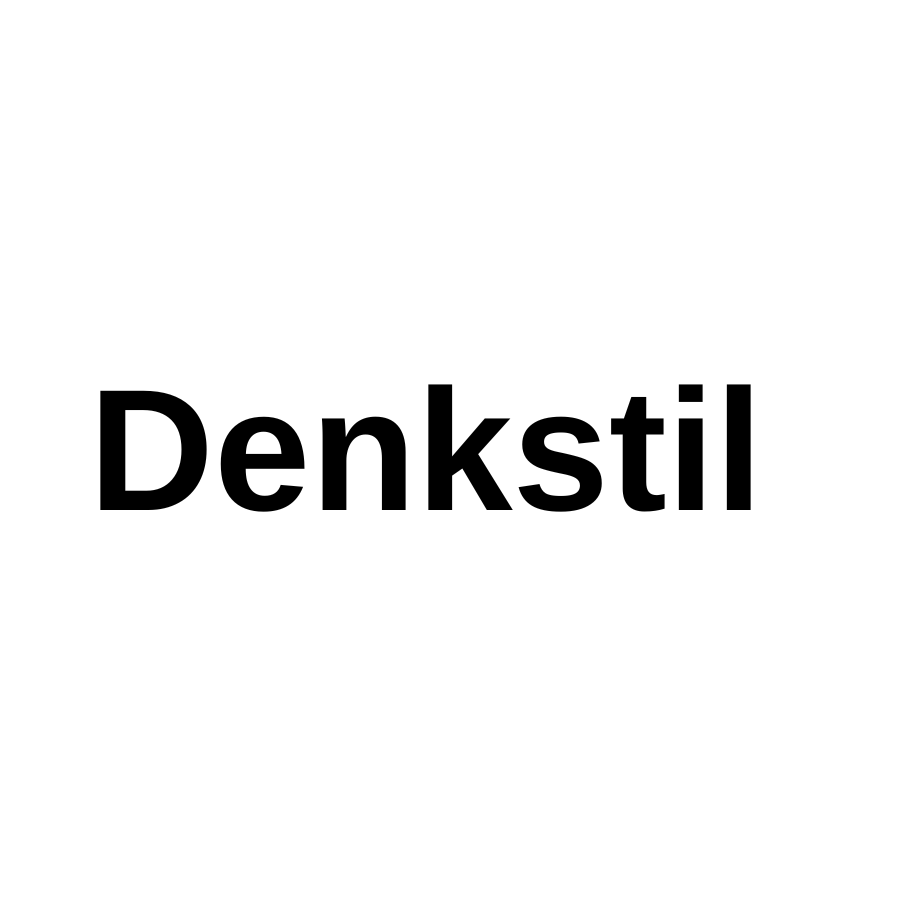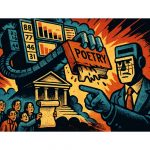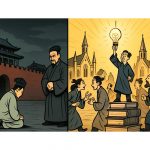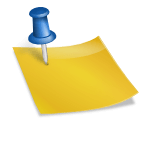607 Millionen Euro für die digitale Nachbildung des menschlichen Gehirns – das Human Brain Project versprach nichts Geringeres als eine wissenschaftliche Revolution. 2009 verkündete Henry Markram in einem TED Talk, die vollständige Gehirnsimulation sei in zehn Jahren realistisch. 2014 rebellierten über 150 Neurowissenschaftler gegen das EU-Vorzeigeprojekt, die Führung wurde ausgetauscht, die Ziele radikal korrigiert. Im September 2023 ging das Projekt zu Ende. Was bleibt, sind 3000 Publikationen, eine Forschungsinfrastruktur und die Erkenntnis: „nicht das Gehirn, sondern Stückchen des Gehirns“. Die Geschichte des HBP offenbart, wie spektakuläre Versprechen die Wissenschaft an der Realität scheitern.
Das Gehirn als Rechenaufgabe – Anatomie eines angekündigten Scheiterns
Als die Europäische Union 2013 das Human Brain Project startete, war die Erwartungshaltung immens. Das Versprechen: Eine vollständige digitale Simulation des menschlichen Gehirns auf Zellebene, ein wissenschaftlicher Quantensprung, der unser Verständnis von Bewusstsein, neurologischen Erkrankungen und künstlicher Intelligenz fundamental verändern würde. 2009 hatte Henry Markram, Professor an der ETH Lausanne, in einem TED Talk verkündet, dass die Simulation des menschlichen Gehirns innerhalb von zehn Jahren realistisch sei. Im Sommer 2014 löste ein offener Protestbrief von zunächst 150, später über 800 teils sehr renommierten Neurowissenschaftlern an die EU-Kommission einen in der Wissenschaft beispiellosen Eklat aus. Im September 2023 ging das Projekt zu Ende – die zentrale Vision blieb unerfüllt, die Führung war längst ausgetauscht, die Ziele fundamental korrigiert. Die Geschichte des HBP ist nicht nur die eines gescheiterten Großprojekts, sondern offenbart grundsätzliche Strukturprobleme europäischer Forschungsförderung.
Was auf den ersten Blick wie wissenschaftliche Ambition erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Systemfehler. Unter dem Druck der internationalen Konkurrenz – vor allem den USA und China – entschloss sich die EU Anfang der 2010er Jahre erstmals, Forschungsprojekte zu fördern, die „große Fragestellungen“ bearbeiten sollten. heise online Um ein EU-Flaggschiffprojekt an Land zu ziehen, war laut dem Mediator Wolfgang Marquardt ein visionärer Ansatz und ein hohes Risiko Bedingung.
Diese Logik kehrt das Verhältnis von Wissenschaft und Politik um: Nicht die Forschungsfrage bestimmt das Projekt, sondern die politische Vermarktbarkeit des Versprechens. Kritiker bemerkten schon damals, dass die Finanzierungszusage der EU recht vage war. Die Vision der Gehirnsimulation war nie ein realistisches wissenschaftliches Ziel, sondern ein Narrativ zur Mobilisierung von Ressourcen. Viele Neurowissenschaftler hielten diese Vision von Beginn an für unerreichbar.
Das Projekt wurde schließlich mit insgesamt 607 Millionen Euro über 155 kooperierende Institutionen aus 19 Ländern gefördert Forschungszentrum JülichHuman Brain Project – eine immense Summe, deren Opportunitätskosten systematisch ausgeblendet wurden. Das Problem liegt nicht im Scheitern an einer schwierigen Aufgabe, sondern in der bewussten Inszenierung eines unrealistischen Versprechens als Grundlage für Forschungsförderung.
Die Kontroverse eskalierte, als das dreiköpfige Leitungsteam um Markram im Mai 2014 ein den kognitiven Neurowissenschaften gewidmetes Subprojekt ersatzlos strich – ausgerechnet jenen Bereich, der die Verbindung zwischen Zellebene und Verhalten hätte herstellen sollen. Der Schlichter Marquardt beschrieb den Konflikt als Auseinandersetzung zwischen Realisten aus der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung und Visionären, die bereit waren, mit einem hohen Risiko des Scheiterns zu leben. Diese Darstellung verschleiert jedoch das eigentliche Problem: Es ging nicht um Risikobereitschaft, sondern um die Frage, ob wissenschaftliche Projekte mit unrealistischen Versprechen legitimiert werden dürfen.
Die nachfolgende Mediation und Reorganisation im Jahr 2015 wird in der offiziellen Darstellung als Erfolg der Selbstkorrektur präsentiert. Tatsächlich dokumentiert sie das Ausmaß der Fehlkonstruktion. Die Führungsstruktur musste dezentralisiert, die kognitive Neurowissenschaft mit mindestens zehn Prozent des Budgets reinstalliert, eine neue Kultur der „realistischen Kommunikation“ etabliert werden.
Die EU-Expertenkommission forderte in ungewohnt deutlicher Sprache, „um jeden Preis“ die Erzeugung zu hoher Erwartungen zu verhindern – eine bemerkenswerte Formulierung, die eingesteht, dass genau dies die Grundlage des Projekts gewesen war. Der Mediator Marquardt stellte fest: „Man sollte nicht mehr den Eindruck erwecken, dass man mit den Ergebnissen des HBP Krankheiten heilen oder Verhaltensweisen vorherbestimmen können wird.“ Im Februar 2015 wurde die bisherige Leitung des Projektes abgesetzt und durch ein neues Gremium ersetzt. Markram war faktisch aus dem Spiel.
Diese Korrektur wirft die Frage auf: Wenn die ursprünglichen Versprechen unrealistisch waren, warum wurden sie dann gemacht? Und warum wurde das Projekt nach dieser Einsicht nicht beendet, sondern mit fundamental veränderten Zielen fortgeführt? Die Antwort liegt in der politischen Ökonomie von Großforschungsprojekten. 607 Millionen Euro können nicht einfach zurückgegeben werden, Institutionen haben Strukturen aufgebaut, Karrieren hängen am Projekt, nationale Prestigefragen sind involviert. Also findet eine schleichende Zielverlagerung statt, die als pragmatische Anpassung kommuniziert wird.
Das transformierte HBP entwickelte sich unter der neuen wissenschaftlichen Leitung von Katrin Amunts ab 2016 zu einer Infrastrukturinitiative. Die digitale Plattform EBRAINS, ein dreidimensionaler Hirnatlas, prädiktive Modelle für bestimmte neurologische Erkrankungen – all das sind zweifellos wertvolle wissenschaftliche Beiträge. Das neue Fernziel wurde die Schaffung einer europäischen Forschungsstruktur in den Neurowissenschaften nach dem Vorbild des CERN. Aus der Gehirnsimulation wurde eine Forschungsinfrastruktur – eine fundamentale Umdefinition, die in der Wissenschaftskommunikation als Erfolgsgeschichte erzählt wird.
Konkrete medizinische Erfolge wurden erreicht: 13 Krankenhäuser in Frankreich testen den „Virtual Epileptic Patient“, eine Plattform mit personalisierten Simulationsmodellen zur Vorhersage chirurgischer Behandlungsstrategien. Forschende aus Lausanne entwickelten eine innovative Rückenmarksstimulation, die es Patienten nach Lähmungen ermöglicht, wieder zu laufen – drei behandelte Patienten konnten innerhalb eines Tages wieder stehen, gehen, schwimmen und radfahren. Kollegen aus Amsterdam entwickelten visuelle Prothesen, Elektrodenarrays im Gehirn, die Menschen mit Netzhautschäden wieder Objekte und Bewegungen erkennen lassen sollen. Diese Erfolge sind real und bedeutsam – sie haben jedoch mit der ursprünglichen Vision der vollständigen Gehirnsimulation nichts gemein.
Die offizielle Bilanz klingt beeindruckend: über 3000 Publikationen, mehr als 160 frei zugängliche digitale Werkzeuge, die EBRAINS-Forschungsinfrastruktur. Doch auch zum Projektende bleiben kritische Stimmen. Yves Frégnac, HBP-Mitglied und Kognitionswissenschaftler, stellte fest: „Die wissenschaftlichen Ergebnisse wurden fragmentiert und mosaikartig.“ Der französische Kognitionsforscher kritisierte das initial geäußerte Versprechen als zu vollmundig: Was er nun am Computer sehen könne, sei „nicht das Gehirn, sondern Stückchen des Gehirns“.
Wie viele kleinere, fokussierte Forschungsprojekte hätten mit 607 Millionen Euro gefördert werden können? Wie viel Grundlagenforschung ohne mediales Echo, wie viele Nachwuchswissenschaftler hätten davon profitiert? Die Opportunitätskosten von Großprojekten werden systematisch ausgeblendet. Tatsächlich wurde das Human Brain Project mit rund 600 Millionen Euro gefördert – dennoch blieb die EU bei diesem Modell der Projektförderung.
Das HBP steht paradigmatisch für eine Entwicklung in der europäischen Forschungslandschaft: die Präferenz für Großprojekte mit visionären Narrativen gegenüber breiter Grundlagenförderung. Diese Tendenz folgt einer politischen Logik, die Sichtbarkeit und vermeintliche „Moonshots“ höher bewertet als die geduldige Akkumulation wissenschaftlichen Wissens. Das Problem liegt nicht in der Ambition selbst – Wissenschaft braucht kühne Hypothesen. Das Problem liegt im Missbrauch des wissenschaftlichen Prozesses durch die Notwendigkeit, Forschung mit unrealistischen Versprechen zu legitimieren.
Die nachhaltige Wirkung des HBP wird sich erst zeigen, wenn klar wird, ob EBRAINS tatsächlich von der neurowissenschaftlichen Community genutzt wird oder ob es zu einem weiteren digitalen Monument europäischer Forschungspolitik verkommt – technisch funktionsfähig, aber in der Praxis irrelevant. Die Plattform EBRAINS verfügt als Teil der sogenannten ESFRI-Roadmap mittlerweile über eine Art EU-Gütesiegel und bleibt frei zugänglich. Nationale Nachfolgeprojekte sind in Deutschland, Italien und Frankreich auf Schiene. science.ORF.at Die Geschichte ist voll von Infrastrukturen, die gebaut wurden, weil sie gebaut werden konnten, nicht weil sie gebraucht wurden.
Was das Human Brain Project lehrt, ist weniger über das Gehirn als über die Defizite europäischer Wissenschaftspolitik. Es zeigt, wie die Vermengung von Forschung, Politik und Prestige zu Projekten führt, die ihre Existenzberechtigung aus spektakulären Versprechen beziehen, nicht aus wissenschaftlicher Notwendigkeit. Es illustriert, wie Zielverlagerungen während der Laufzeit als Flexibilität kommuniziert werden, obwohl sie das Eingeständnis des Scheiterns darstellen. Und es dokumentiert, wie systematisch die Opportunitätskosten von Großprojekten ausgeblendet werden.
Das menschliche Gehirn bleibt unentschlüsselt. Die Simulation, die das HBP versprach, war nie realistisch – und die Verantwortlichen wussten das. Was Markram 2009 als realistische Zehn-Jahres-Vision verkaufte, erwies sich als Inszenierung. Was bleibt, ist eine Forschungsinfrastruktur von ungewissem Nutzen, ein Berg an Publikationen, medizinische Fortschritte, die auch ohne die Großstruktur möglich gewesen wären – und die Gewissheit, dass 607 Millionen Euro anders hätten investiert werden können. Die eigentliche Herausforderung liegt nicht in der Simulation des Gehirns, sondern in der Überwindung einer Forschungspolitik, die spektakuläre Versprechen über wissenschaftliche Redlichkeit stellt. Solange europäische Forschungsförderung nach der Logik politischer Inszenierung funktioniert, wird das HBP nicht das letzte Projekt dieser Art bleiben.
Quellen:
(2014-2015):
Spektrum der Wissenschaft (9. März 2015): „Human Brain Project vor radikaler Neuorganisation“
https://www.spektrum.de/news/human-brain-project-vor-radikaler-neuorganisation/1335986
Süddeutsche Zeitung (URL bereitgestellt): „Hirnforschung im Human Brain Project: Dicke Schädel, falsche Versprechen“
https://www.sueddeutsche.de/wissen/hirnforschung-im-human-brain-project-dicke-schaedel-falsche-versprechen-1.2457950
Neuro-Hype: Einige Anmerkungen zur Hirnforschung
Aktuelle Quellen zum Projektabschluss (2023):
Heise Online (20. September 2023): „Umstrittene Bilanz für das Human Brain Project“
https://www.heise.de/news/Umstrittene-Bilanz-fuer-das-Human-Brain-Project-9310298.html
Schweizer Radio und Fernsehen SRF (29. September 2023): „Das Human Brain Project geht zu Ende: Was bleibt?“
https://www.srf.ch/wissen/gesundheit/umstrittenes-virtuelles-gehirn-das-human-brain-project-geht-zu-ende-was-bleibt
ORF Science (16. September 2023): „Bilanz: Was das ‚Human Brain Project‘ gebracht hat“
https://science.orf.at/stories/3221259/
Spektrum der Wissenschaft (2023): „Human Brain Project: Die Vision vom simulierten Hirn“
https://www.spektrum.de/magazin/human-brain-project-die-vision-vom-simulierten-hirn/2175555
Forschungszentrum Jülich (12. September 2023): „Human Brain Project feiert erfolgreichen Abschluss“
https://www.fz-juelich.de/de/aktuelles/news/pressemitteilungen/2023/human-brain-project-feiert-erfolgreichen-abschluss
Helmholtz-Gemeinschaft (2023): „Ein Schlüssel für die weitere Hirnforschung“ – Interview mit Katrin Amunts
https://www.helmholtz.de/newsroom/artikel/ein-schluessel-fuer-die-weitere-hirnforschung/
Europäische Kommission (28. März 2023): „Final Human Brain Project Summit: Achievements and Future of Digital Brain Research“
https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/news/final-human-brain-project-summit-achievements-and-future-digital-brain-research
Human Brain Project Official (28. September 2023): „The Human Brain Project ends: What has been achieved“
https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/2023/09/28/human-brain-project-ends-what-has-been-achieved/