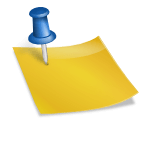Dieser Beitrag analysiert die fundamentale Krise moderner Kriegsführung anhand von Martin van Crevelds historischer Militäranalyse und Edward Luttwaks Theorie der paradoxen Strategielogik. Die zentrale These: Seit dem Ersten Weltkrieg verspricht die militärische Doktrin, dass technologische Überlegenheit Kriege entscheidet – doch von Vietnam bis Afghanistan, von Irak bis Ukraine zeigt sich das Gegenteil. Die mächtigsten Armeen der Welt scheitern regelmäßig an technisch unterlegenen Gegnern oder können keine militärischen Entscheidungen mehr erzwingen.
Van Creveld demonstriert empirisch, wie die Transformation der Kriegsführung seit 1914 – von Massenheeren über industrielle Logistik bis zur nuklearen Abschreckung – in eine strategische Sackgasse führte. Der Wendepunkt von Hiroshima 1945 machte direkte Konflikte zwischen Atommächten unmöglich. Gleichzeitig zeigt sich: Technologische Qualität ohne quantitative Basis ist wertlos, wie Europas Munitionsmangel im Ukraine-Konflikt brutal offenlegt.
Luttwak liefert die theoretische Erklärung: Strategie folgt einer paradoxen, gegen Alltagslogik gerichteten Logik. Maßnahmen erreichen oft das Gegenteil ihres Zwecks. Erfolge schlagen an ihrem Höhepunkt („culminating point“) ins Gegenteil um. Jede Innovation wird neutralisiert, jede Aktion erzeugt Gegenreaktionen. Der Ukraine-Konflikt illustriert dies perfekt: Weder russische Masse noch ukrainische Kombination aus westlicher Technologie und Verteidigungsvorteil können eine Entscheidung herbeiführen.
Die Analyse enthüllt eine strukturelle Heuchelei: Politische und wirtschaftliche Eliten propagieren Kriege, deren Hauptlast andere tragen. Sie fordern massive Aufrüstung (NATO-Ziel: 5% des BIP bis 2035), während die realen militärischen Kapazitäten fehlen – die Bundeswehr könnte mit ihren Munitionsbeständen keine zwei Tage kämpfen. Eine direkte NATO-Intervention in der Ukraine ist deshalb unmöglich: nuklear blockiert, industriell deindustrialisiert, logistisch überfordert, gesellschaftlich abgelehnt (80% der Deutschen, 90% der Polen lehnen Truppeneinsatz ab).
Die düstere Schlussfolgerung: Moderne Kriegsführung produziert keine Sieger mehr, sondern nur unterschiedlich stark Geschädigte in endlosen Abnutzungskonflikten. Die Illusion technologischer Überlegenheit dient als ideologische Legitimation für eine Praxis, die an ihren eigenen Widersprüchen scheitert – militärisch, strategisch-logisch und moralisch. Wer heute von militärischen Lösungen spricht, ignoriert sowohl empirische Befunde als auch die paradoxe, selbstzerstörerische Natur militärischen Handelns in der Moderne.
Seit dem Ersten Weltkrieg versprachen Militärstrategen, dass überlegene Technologie die Schlacht entscheidet. Doch von Vietnam bis Afghanistan zeigt sich: Die mächtigsten Armeen der Welt scheitern regelmäßig an technisch unterlegenen Gegnern. Martin van Crevelds Militärgeschichte und Edward Luttwaks Theorie der paradoxen Strategielogik enthüllen einen fundamentalen Bruch – und die Heuchelei einer Elite, die Kriege befürwortet, deren Hauptlast andere tragen.
Es gehört zu den bemerkenswertesten Konstanten der Kriegsgeschichte, dass diejenigen, die am lautesten für militärische Konflikte plädieren, selten selbst an der Front zu finden sind. Die politischen und wirtschaftlichen Eliten, die Kriege konzipieren, legitimieren und profitabel gestalten, exponieren weder sich selbst noch ihre Familien den Gefahren, die sie anderen zumuten. Der Krieg erweist sich damit als zutiefst ungerechtes Projekt: konzipiert von wenigen, die sich als Elite verstehen, ausgeführt und erlitten von der Masse, die an der Front kämpft, stirbt und traumatisiert wird. Diese strukturelle Heuchelei – die Propagierung heroischer Opferbereitschaft durch jene, die selbst kein Risiko eingehen – durchzieht die gesamte moderne Kriegsgeschichte und entlarvt militärische Rhetorik als das, was sie häufig ist: ein elitär gelenktes Geschäftsmodell, das enorme Profite für wenige auf Kosten vieler generiert.
Der Militärhistoriker Martin van Creveld liefert in seinem Werk „Gesichter des Krieges – Der Wandel bewaffneter Konflikte von 1900 bis heute“ eine präzise Analyse dieser Transformation. Seine Darstellung zeigt, wie sich das Wesen des Krieges im 20. Jahrhundert fundamental veränderte und dabei jene Widersprüche verschärfte, die bereits in seiner elitären Konzeption angelegt waren. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs folgten bewaffnete Konflikte relativ überschaubaren Mustern: Das Pferd als zentrales Fortbewegungsmittel, konzentrierte Streitmächte, die sich auf begrenztem Raum zur Entscheidungsschlacht stellten. Wer über ausreichende Verpflegung für Tier und Mannschaft verfügte, konnte strategische Vorstöße unternehmen. Die militärische Logik war, bei aller Brutalität, noch einigermaßen transparent.
Mit der Einführung von Massenheeren, die sich nicht mehr ausschließlich aus Berufssoldaten rekrutierten, und dem Aufkommen neuer Technologien wie moderner Artillerie und Maschinengewehren brach diese Übersichtlichkeit zusammen. Van Creveld berechnet, dass während im amerikanischen Sezessionskrieg noch neun von zehn Mann Kombattanten waren, dieser Anteil bis 1914 auf fünf von zehn sank.
Gleichzeitig zwang die moderne Feuerkraft die Truppen zur Zerstreuung – jeder Soldat beanspruchte nun etwa zwanzigmal so viel Raum wie zur Zeit Napoleons. Die Armeen wuchsen auf Millionenstärke an und übertrafen damit die Kapazitäten der Eisenbahnen, auf die sie für den Transport angewiesen waren. Die Konsequenz: Es bestand schlicht nicht mehr die Möglichkeit, die eigenen Hauptkräfte zu konzentrieren und dem Gegner auf einem einzigen Feld eine entscheidende Schlacht zu liefern. Selbst dramatische Siege an der Front bedeuteten meist nur noch, dass ein Bruchteil der gegnerischen Gesamtarmee besiegt worden war.
Diese räumliche Ausdehnung stellte die militärische Kommunikation vor unlösbare Herausforderungen. Solange Truppen an Ort und Stelle blieben, funktionierten drahtgestützte Telegraphen und Telefone zufriedenstellend. Jeder Vorstoß jedoch führte dazu, dass diese Geräte zurückgelassen werden mussten. Vorrückende Truppen verlegten zwar Kabel, das Ergebnis war aber meist nur eine notdürftige und unzuverlässige Verbindung. Die Koordination des Artilleriefeuers mit den Bewegungen der Infanterie erwies sich als außerordentlich schwierig. Ohne funktionsfähige, tragbare Funkgeräte blieb man auf Kundschafter und Luftbeobachter angewiesen – eine prekäre Informationsbasis für Entscheidungen über Leben und Tod Zehntausender.
Die logistischen Anforderungen explodierten parallel. Zwischen 1914 und 1916 verdreifachte sich das geschätzte Gewicht der erforderlichen Nachschubmenge für eine normale Infanteriedivision von 50 auf 150 Tonnen pro Tag. Den größten Anteil beanspruchten Munition für schnellfeuernde Waffen, Ersatzteile und Baumaterialien für Gräben. Als sich gegen Kriegsende die Zahl der Motorfahrzeuge und Flugzeuge vervielfachte, kam Treibstoff hinzu – allein die deutsche Luftwaffe verbrauchte 1918 monatlich 7.000 Tonnen Benzin. Der Krieg hatte sich in ein gigantisches technisch-logistisches Unternehmen verwandelt, dessen Komplexität die Fähigkeiten traditioneller militärischer Führung überstieg.
Im Zweiten Weltkrieg erreichte diese Entwicklung einen neuen Höhepunkt. Mindestens vier Felder waren derart komplex geworden, dass selbst Regierungschefs und Oberbefehlshaber Experten – oft Zivilisten – um Rat fragen mussten: Forschung und Entwicklung, die ständig wechselnden Waffen und Waffensysteme, operative Forschung zur Findung der besten Einsatzmethoden und Nachrichtenbeschaffung. Die technologische Findigkeit der Deutschen erwies sich dabei als zweischneidiges Schwert. Sie führte zu einer sehr großen Zahl verschiedener Typen, Modelle und Versionen von Waffen, was häufige Änderungen, Unterbrechungen des Produktionszyklus und endlose Wartungsprobleme nach sich zog. Ende 1941 benötigte die Heeresgruppe Mitte vor Moskau eine Million verschiedene Ersatzteile – ein logistischer Albtraum.
Der technologische Wettlauf zwischen den Kriegsparteien führte zu spektakulären Entwicklungen in Bereichen wie Radar, Elektronik und Kryptographie. Das legendäre britische Projekt Ultra, bei dem es gelang, die deutsche Verschlüsselungsmaschine Enigma zu knacken, steht exemplarisch für diese neue Dimension der Kriegsführung. Doch selten war ein technologischer Vorsprung von langer Dauer. Manche Erfindungen wie Annäherungszünder wurden sogar aus Angst zurückgehalten, der Feind könnte sie kopieren. Die Japaner blieben ab 1942 zunehmend hinter ihren Gegnern zurück, während die Deutschen zwar in mehreren Feldern Pionierarbeit leisteten, aber auch auf dem Feld der Elektronik ständig Abwehrmaßnahmen gegen alliierte Entwicklungen treffen mussten.
Luttwaks paradoxe Logik: Wenn Fortschritt zum Stillstand führt
Der amerikanische Strategietheoretiker Edward Luttwak liefert in „The Logic of War and Peace“ einen konzeptionellen Rahmen, der van Crevelds Beobachtungen theoretisch unterfüttert. Luttwak argumentiert, dass Strategie einer paradoxen, gegen die Alltagslogik gerichteten Logik folgt: Maßnahmen erreichen oft das Gegenteil ihres eigentlichen Zwecks, insbesondere wenn sie ihren „culminating point“ – ihren Höhepunkt – erreichen.
Der technologische Wettlauf im Zweiten Weltkrieg illustriert diese paradoxe Logik perfekt. Jede Innovation wurde vom Gegner kopiert oder durch Gegenmaßnahmen neutralisiert. Technologien boten stets nur kurzfristige Vorteile – genau wie Luttwak es beschreibt. Die Dialektik des Konflikts, das Wechselspiel von Aktion und Reaktion, führte dazu, dass keine Seite einen dauerhaften technologischen Vorsprung erringen konnte. Van Crevelds Feststellung, dass „selten ein technologischer Vorsprung von langer Dauer war“, ist die empirische Bestätigung von Luttwaks theoretischer Einsicht.
Noch deutlicher wird die paradoxe Logik bei der Atombombe: Die ultimative Waffe zur Erzwingung militärischer Entscheidungen machte genau solche Entscheidungen unmöglich. Der Höhepunkt militärischer Macht schlug in absolute strategische Lähmung um – Luttwaks „culminating point“ in Reinform. Das Prinzip „Si vis pacem, para bellum“ (Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor) erreichte mit der nuklearen Abschreckung seine extremste Ausprägung: Die Vorbereitung des absoluten Krieges erzwingt den Frieden, macht aber gleichzeitig konventionelle Kriege zwischen Atommächten unmöglich.
Nach 1945 etablierte sich in Militärkreisen die Auffassung, dass zahlenmäßige Überlegenheit für einen Sieg nicht mehr ausreichte und sich quantitative Defizite durch den Einsatz überlegener Technologien zumindest ausgleichen ließen. Van Creveld stellt diese Annahme radikal infrage. Der Sieg der Koalitionstruppen 1991 im Irak verdankte sich mindestens ebenso sehr der überwältigenden materiellen Überlegenheit wie dem technologischen Vorsprung. Als die NATO 1999 Serbien besiegte, übertrafen die Flugzeuge der Koalition die serbische Luftwaffe im Verhältnis 40:1. Der zweite Irakkrieg 2003 bewies lediglich, dass ein Elefant, wenn er auf eine Ameise tritt, dieselbe zermalmt. Das Gerede von der Qualität, die angeblich an die Stelle der Quantität getreten war, diente nur dazu, die Tatsache zu verschleiern, dass die Gegner außerordentlich schwach gewesen waren.
Wären überlegene Technologien für den Erfolg tatsächlich entscheidend, hätten sich die Sowjetunion und später die USA nicht aus Afghanistan zurückziehen müssen. Der Vietnamkrieg steht dabei als historisches Paradigma für das Scheitern technologischer Überlegenheit. Doch die jüngsten Konflikte in Irak und Afghanistan bestätigen dieses Muster auf dramatische Weise. Van Crevelds Diagnose ist vernichtend: Die mächtigste Kriegsmaschine der Geschichte verschlang fast 450 Milliarden Dollar im Jahr, mühte sich aber vergeblich, 20.000 bis 30.000 Rebellen zu besiegen. Drei Tage vor Weihnachten töteten die Rebellen sogar 19 US-Soldaten, während diese im befestigten Stützpunkt ihr Mittagessen einnahmen. Ihre ultramodernen Sensoren, raffinierten Kommunikationsverbindungen und zahllosen Computer konnten nicht verhindern, dass ihre Gegner nach Belieben schalteten und walteten, wo, wann und wie immer sie wollten. Geblendet von des Kaisers neuen Kleidern sehen die meisten Menschen in technologischen Studien den Beweis für Modernität und Fortschritt. In Wirklichkeit ist es häufig ein Zeichen der Irrelevanz, des Niedergangs und der Unfähigkeit, da viele der stärksten Truppen der Welt vergeblich versuchen, mit Gegnern fertig zu werden, die so viel kleiner und schwächer sind, dass der Sieg eigentlich gar nicht in Frage stehen sollte.
Den entscheidenden Wendepunkt in der Militärgeschichte markiert für van Creveld der 6. August 1945: die Detonation der ersten Atombombe über Hiroshima. Das Massensterben beendete abrupt die Kombination aus sich ständig verbessernder Technik und immer größer werdender Truppenstärke. Hiroshima und Nagasaki dürften der wichtigste Wendepunkt sein, seit sich Menschen zum ersten Mal organisierten und vor Zehntausenden Jahren mit Stöcken und Steinen in den Krieg zogen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Militärgeschichte geradlinig in einer Richtung verlaufen. Von da an wurde sie vom Kurs abgebracht und schlug eine neue Richtung ein.
Seitdem geraten militärstrategische Überlegungen irgendwann an einen toten Punkt. Nachdem die Supermächte sich jahrzehntelang wütend angestarrt hatten, mussten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion einsehen, dass die alten Regeln nicht mehr galten und dass man nur gewinnen konnte, wenn man sich gar nicht erst auf ein Spiel einließ. Die übrigen Länder folgten eines nach dem anderen. Da niemals eine wirksame Verteidigung gegen einen atomaren Angriff entwickelt wurde, wagte es selbst Präsident Bush bei einem Kräfteverhältnis von tausend zu eins und trotz aller großen Worte über die „Achse des Bösen“ nicht, gegen Nordkorea so vorzugehen wie gegen den Irak.
Der Ukraine-Konflikt: Van Crevelds Thesen treffen auf brutale Gegenwart
Van Crevelds Analyse erweist sich im gegenwärtigen Ukraine-Konflikt als erschreckend prophetisch. Alle von ihm identifizierten Widersprüche moderner Kriegsführung manifestieren sich hier mit brutaler Klarheit – und offenbaren gleichzeitig, warum eine direkte NATO-Intervention trotz aller Rhetorik unmöglich bleibt.
Die nukleare Blockade in Reinform
Die NATO hat wiederholt klargestellt, dass sie keine Truppen in die Ukraine entsenden wird, weil dies zu einem direkten Konflikt mit Russland führen würde. Dies ist exakt van Crevelds Kernthese nach Hiroshima: Seit 1945 können Atommächte nicht mehr direkt gegeneinander Krieg führen, ohne die Gefahr der totalen Eskalation einzugehen. Der polnische Außenminister Sikorski räumte ein, dass Europa in einem konventionellen Krieg gegen Russland im Nachteil wäre, weshalb die Gefahr besteht, dass die NATO in einem solchen Konflikt auf Atomwaffen zurückgreifen könnte.
Die strategische Logik entspricht der des Kalten Krieges: Man kann nur gewinnen, wenn man sich gar nicht erst auf das Spiel einlässt. Umfragen zeigen, dass 68 Prozent der Franzosen, 80 Prozent der Deutschen und 90 Prozent der Polen eine Entsendung von NATO-Truppen ablehnen World Socialist Web Site – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bevölkerung die Eskalationsrisiken besser versteht als manche politischen Eliten. Hier offenbart sich erneut die eingangs beschriebene strukturelle Heuchelei: Während Politiker über mögliche Interventionen spekulieren, lehnt die Bevölkerung, die die Hauptlast tragen müsste, dies mit überwältigender Mehrheit ab.
Die Entlarvung der Qualitäts-Illusion
Van Crevelds Kritik am „Gerede von der Qualität statt Quantität“ erweist sich im Ukraine-Krieg als brutale Realität. Der monatliche Bedarf der ukrainischen Streitkräfte beträgt rund 200.000 Schuss 155-mm-Munition. Die EU versprach im März 2023, innerhalb von zwölf Monaten eine Million Artilleriegranaten zu liefern, schaffte aber bis März 2024 nur etwa 30 bis 50 Prozent dieser Menge.
Die strukturellen Defizite sind verheerend: Der Bundeswehr fehlt Munition im Wert von 20 bis 30 Milliarden Euro, und insbesondere bei Artilleriemunition mit Kaliber 155 mm ist der Bestand sehr weit von der NATO-Vorgabe eines 30-Tage-Vorrats entfernt ESUT. Die Bundeswehr könnte mit ihren vorhandenen Artilleriemunitionsbeständen keine zwei Tage Kampf im Krieg bestreiten Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Dies ist die konkrete Konsequenz jener Deindustrialisierung, die van Creveld für die Nachkriegszeit diagnostizierte.
Währenddessen hat Russland seine Produktionskapazitäten massiv ausgebaut. Expertenschätzungen zufolge produzierte Russland bereits 2022 rund 1,7 Millionen Schuss Artilleriemunition, mit einem Produktionsziel von 3 Millionen für 2025. Van Crevelds These bestätigt sich brutal: Qualität ohne ausreichende Quantität ist militärisch wertlos. Die hochmodernen Sensoren und raffinierten Kommunikationsverbindungen helfen wenig, wenn schlicht die Grundmunition fehlt.
Die Deindustrialisierung als strategisches Versagen
Sikorski diagnostiziert: „Europa hat sich nach 1991 nicht nur abgerüstet, sondern im Bereich der Verteidigung deindustrialisiert. Wir haben uns auf hochwertige Hightech-Plattformen konzentriert und entdecken erst jetzt wieder, dass man eigentlich nur Millionen Geschosse braucht“ World Socialist Web Site. Das ist eine vernichtende Bestätigung von van Crevelds Kritik: Europa fiel auf „des Kaisers neue Kleider“ herein und vernachlässigte die profane, aber kriegsentscheidende Massenproduktion.
Die USA verdoppelten ihre Produktionskapazitäten von monatlich 14.000 auf 28.000 Schuss, während der europäische Kapazitätsausbau nur schleppend vorankommt. Die europäische Munitionsindustrie versucht mit Hochdruck aufzurüsten, aber dies dauert Jahre – in den letzten Jahrzehnten wurde zu viel an Produktionsmöglichkeiten abgebaut. Die Ironie ist bitter: Während man sich jahrzehntelang auf technologische Überlegenheit konzentrierte, fehlt es nun an der banalen Fähigkeit, ausreichend konventionelle Artilleriegeschosse zu produzieren.
Das Paradox der Nicht-Entscheidung: Wenn weder Masse noch Qualität siegen
Hier offenbart sich allerdings ein scheinbarer Widerspruch zu van Crevelds These: Wenn russische Quantität so entscheidend wäre, hätte die Ukraine längst kapitulieren müssen. Tatsächlich hält sie seit bald drei Jahren stand – trotz erheblicher zahlenmäßiger Unterlegenheit und chronischem Munitionsmangel. Widerlegt dies van Crevelds Analyse? Im Gegenteil: Es bestätigt sie auf eine noch tiefgründigere Weise – und illustriert gleichzeitig Luttwaks Konzept der paradoxen Strategielogik in bemerkenswerter Klarheit.
Luttwaks Dialektik in Aktion
Der Ukraine-Konflikt demonstriert Luttwaks zentrale These: Strategie folgt keiner geradlinigen, vernunftgeleiteten Logik. Stattdessen zeigt sich eine paradoxe Dynamik auf allen Ebenen:
- Auf der technischen Ebene: Westliche Präzisionswaffen sollten russische Masse neutralisieren – wurden aber durch russische elektronische Kriegsführung und Gegenmaßnahmen zunehmend entwertet. Jeder technologische Vorteil erwies sich als temporär.
- Auf der operativen Ebene: Russlands zahlenmäßige Überlegenheit sollte schnelle Durchbrüche ermöglichen – führte aber zu enormen Verlusten und stagnierender Front. Die ukrainische Gegenoffensive 2023 sollte Territorium zurückgewinnen – endete in einer kostspieligen Pattsituation
- Auf der strategischen Ebene: Westliche Waffenlieferungen sollten die Ukraine zum Sieg befähigen – ermöglichen aber nur das Hinauszögern der Niederlage. Russlands „Spezialoperation“ sollte in wenigen Tagen enden – wurde zum jahrelangen Abnutzungskrieg.
- Auf der „grand strategy“-Ebene: Die NATO-Osterweiterung sollte Sicherheit schaffen – provozierte (aus russischer Sicht) genau jenen Konflikt, den sie verhindern sollte. Westliche Sanktionen sollten Russland schwächen – führten zu europäischer Energiekrise und Inflation.
Die Verteidigung als temporärer Ausweg
Die Ukraine demonstriert, dass in der Defensive und mit westlicher Unterstützung eine technologisch und taktisch überlegene Armee einer zahlenmäßig weit überlegenen Kraft standhalten kann – zumindest zeitweise. Mehrere Faktoren spielen zusammen: Überlegene westliche Aufklärungstechnologie, präzise Waffensysteme, bessere Führung, höhere Motivation und nicht zuletzt die inhärenten Vorteile der Verteidigung. Hinzu kommt die dokumentierte russische Inkompetenz, Korruption und strategische Fehlentscheidungen, die die zahlenmäßige Überlegenheit teilweise neutralisieren.
Doch „standhalten“ bedeutet nicht „siegen“. Die Ukraine verliert kontinuierlich Territorium, wenn auch langsam. Die menschlichen Verluste auf beiden Seiten sind enorm. Von den großangelegten Gegenoffensiven des Jahres 2023 ist nichts geblieben. Was sich etabliert hat, ist ein zermürbender Abnutzungskrieg, in dem keine Seite einen strategischen Durchbruch erzielt, beide aber systematisch Ressourcen und Menschenleben verbrauchen.
Der Krieg ohne Entscheidung als Bestätigung beider Theorien
Genau dies ist die Synthese von van Creveld und Luttwak: Moderne Kriege tendieren dazu, sich in endlose Abnutzungskonflikte zu verwandeln, in denen weder technologische Überlegenheit noch zahlenmäßige Masse eine schnelle Entscheidung herbeiführen können – weil die paradoxe Logik der Strategie jede lineare Erfolgsrechnung zunichtemacht. Die Ukraine kann sich mit westlicher Hilfe verteidigen – aber sie kann den Krieg nicht gewinnen. Russland kann langsam vorrücken – aber es kann keinen schnellen, entscheidenden Sieg erringen.
Luttwak würde argumentieren: Beide Seiten haben ihren „culminating point“ erreicht – jenen Punkt, an dem weitere Anstrengungen nicht mehr zu proportionalen Erfolgen führen, sondern in Erschöpfung münden. Russland kann keine schnellen operativen Durchbrüche mehr erzielen, die Ukraine keine großen Gegenoffensiven. Was bleibt, ist Luttwaks Prognose: Nicht der vollständige Sieg einer Seite, sondern „Gleichgewicht oder Erschöpfung“ werden zur Beendigung des Konflikts führen.
Dies ist exakt die „Sackgasse“, die van Creveld beschreibt: Ein Zustand, in dem militärische Mittel keine politische Lösung mehr erzwingen können. Die stärksten Truppen der Welt versuchen vergeblich, mit Gegnern fertig zu werden – nicht weil diese stärker wären, sondern weil moderne Kriegsführung selbst an einen toten Punkt gelangt ist.
Die westliche Paradoxie
Besonders deutlich zeigt sich Luttwaks paradoxe Logik in der westlichen Position:
- Je mehr Waffen der Westen liefert, desto länger dauert der Krieg – aber ohne Aussicht auf ukrainischen Sieg. Die Unterstützung verhindert Niederlage, ermöglicht aber keinen Triumph.
- Je lauter die NATO Beistandsgarantien gibt, desto geringer wird ihre Glaubwürdigkeit – weil die materielle Basis fehlt. Man verspricht Verteidigungsausgaben von fünf Prozent des BIP bis 2035 bpb, während man heute nicht einmal zwei Tage Kampf durchhalten könnte.
- Je mehr man auf technologische Überlegenheit setzt, desto deutlicher wird die Abhängigkeit von quantitativer Masse. Europa entdeckt „erst jetzt wieder, dass man eigentlich nur Millionen Geschosse braucht“ – eine bittere Einsicht, die Luttwaks Warnung vor linearem Denken bestätigt.
- Je erfolgreicher die Ukraine sich verteidigt, desto mehr verfestigt sich der Status quo eines endlosen Konflikts, der keine politische Lösung ermöglicht.
Die Abhängigkeit als strukturelle Schwäche
Entscheidend ist: Die Ukraine hält nur stand, weil sie kontinuierlich westliche Unterstützung erhält. Ohne diese würde van Crevelds Quantitäts-These brutal greifen. Die ukrainische Widerstandsfähigkeit beweist nicht, dass technologische Qualität Masse schlägt – sie beweist, dass eine quantitativ unterlegene Armee mit kontinuierlicher externer Zufuhr von Material und Technologie eine Niederlage hinauszögern kann. Das ist fundamental etwas anderes als ein militärischer Sieg.
Die Folgen des Munitionsmangels zeigen sich brutal: Wegen des kritischen Mangels an Artilleriemunition wird selbst die primitive russische Taktik, einfach Wellen von schlecht ausgebildeten und ausgerüsteten Männern einzusetzen, immer effektiver, da die ukrainische Artillerie sie nicht ausschalten kann, bevor sie die ukrainischen Stellungen erreichen. Das demonstriert: Sobald die westliche Materialzufuhr stockt, bricht die Verteidigungsfähigkeit zusammen.
Das größere strategische Muster
Dieses Muster bestätigt sowohl van Crevelds als auch Luttwaks Analyse in mehrfacher Hinsicht:
- Erstens zeigt es, dass rein defensive Kriege mit externer Unterstützung lang dauern können, aber keine politische Lösung erzwingen. Die Ukraine kann Russland nicht besiegen, sondern nur dessen Vormarsch verlangsamen.
- Zweitens offenbart es, dass auch massive russische Überlegenheit bei Artillerie und Manpower keine schnelle Entscheidung erzwingt – nicht wegen überlegener ukrainischer Technologie, sondern wegen der Natur moderner Kriegsführung selbst, in der Verteidiger mit minimaler technologischer Parität enorme Verluste zufügen können.
- Drittens bestätigt es van Crevelds Diagnose der westlichen Sackgasse: Europa und die USA können der Ukraine genug Material geben, um nicht zu verlieren – aber nicht genug, um zu gewinnen. Und sie können nicht direkt eingreifen wegen der nuklearen Blockade. Das Ergebnis ist ein endloser Stellungskrieg, der an den Ersten Weltkrieg erinnert: hohe Verluste, minimale territoriale Veränderungen, keine militärische Entscheidung.
- Viertens illustriert es Luttwaks Warnung vor linearer Planung: Politische und militärische Entscheider planen rational und linear (mehr Waffen = ukrainischer Sieg, mehr Sanktionen = russischer Kollaps), statt die paradoxen Effekte ihrer Handlungen zu bedenken. Das Ergebnis ist ein Konflikt, dessen unbeabsichtigte Konsequenzen – Energiekrise, Inflation, endloser Stellungskrieg, globale Ernährungskrise – die ursprünglichen Absichten konterkarieren.
Die logistische Sackgasse
Die ukrainische Artillerie hat teilweise eine russische Überlegenheit von 1:20 bis 1:40 zu erdulden und muss ihre verbleibende Munition streng rationieren. Das erinnert fatal an van Crevelds Beschreibung des Ersten Weltkriegs: Die logistischen Anforderungen übersteigen die Kapazitäten bei weitem. Doch während 1914 bis 1918 alle Seiten mit ähnlichen Problemen kämpften, zeigt sich heute eine asymmetrische Konstellation: Russland setzt auf Masse und industrielle Kapazität, während der Westen seine überlegene Technologie nicht in ausreichende Mengen umsetzen kann.
Experten warnen, dass der NATO nur drei bis fünf Jahre bleiben, um ihre Verteidigung gegen eine potenzielle russische Offensive auf das Bündnisgebiet zu stärken. Diese Warnung enthüllt das gesamte Dilemma: Selbst wenn man von einem direkten Angriff auf NATO-Territorium ausgeht – wofür es gegenwärtig keine Hinweise gibt – wäre das Bündnis nicht in der Lage, sich angemessen zu verteidigen. Die viel beschworene Abschreckungsfähigkeit entpuppt sich als teilweise illusorisch, wenn die materielle Basis fehlt.
Die elitäre Rhetorik trifft auf materielle Unmöglichkeit
Die NATO-Mitglieder einigten sich darauf, ihre Verteidigungsbudgets auf fünf Prozent des BIP bis 2035 zu erhöhen, wobei 3,5 Prozent für eigentliche Verteidigungsmaßnahmen verwendet werden sollen bpb. Diese enormen Summen werden gefordert, während gleichzeitig die realen militärischen Kapazitäten fehlen und die Bevölkerung eine direkte Beteiligung massiv ablehnt. Man verspricht gigantische Investitionen in eine Zukunft, während man in der Gegenwart nicht einmal die basalsten Kriegsmaterialien in ausreichender Menge bereitstellen kann.
Die eingangs beschriebene strukturelle Heuchelei offenbart sich hier in ihrer ganzen Deutlichkeit: Politische Eliten fordern massive Aufrüstung und diskutieren Truppeneinsätze, während die Bevölkerung dies mit überwältigender Mehrheit ablehnt und die tatsächlichen militärischen Fähigkeiten weit hinter der Rhetorik zurückbleiben. Es ist das perfekte Beispiel für ein elitäres Projekt, bei dem diejenigen, die die strategischen Entscheidungen treffen, nicht selbst die Konsequenzen tragen müssen.
Die unmögliche Intervention
Ein direktes NATO-Eingreifen würde alle von van Creveld identifizierten Widersprüche brutal offenlegen. Die nukleare Blockade verhindert eine direkte Konfrontation mit Russland. Die Illusion technologischer Überlegenheit zerschellt an der Unfähigkeit, ausreichende Mengen konventioneller Munition bereitzustellen. Die logistische Unmöglichkeit zeigt sich daran, dass Europa nicht einmal die Ukraine angemessen mit Material versorgen kann – wie sollte es dann einen eigenen konventionellen Krieg führen? Und das elitäre Projekt scheitert daran, dass die Bevölkerung eine Beteiligung massiv ablehnt, während gleichzeitig die realen Kapazitäten für eine solche Operation fehlen.
Van Crevelds Diagnose erweist sich als erschreckend aktuell: Europas Streitkräfte stehen genau in jener „Sackgasse“, die er beschreibt – technologisch ambitioniert, industriell deindustrialisiert, nuklear blockiert und in der Lage, nur gegen deutlich schwächere Gegner anzutreten. Die eigentliche Heuchelei besteht darin, diese Unmöglichkeit nicht offen einzugestehen, sondern stattdessen die Illusion militärischer Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, während man gleichzeitig nicht einmal in der Lage ist, die basalsten Kriegsmaterialien in ausreichender Menge zu produzieren.
Die bittere Wahrheit
Die Ukraine „hält wacker dagegen“ – aber zu welchem Preis? Das Land wird systematisch zerstört, verliert kontinuierlich Territorium und Menschen, während seine Verteidigungsfähigkeit vollständig von westlicher Materialzufuhr abhängt, die nie ausreicht und deren Fortsetzung politisch unsicher ist. Dies ist keine Widerlegung von van Crevelds These, sondern deren vollständige Bestätigung: Moderne Kriegsführung endet in einer Sackgasse, in der niemand gewinnen kann, aber alle verlieren – militärisch, ökonomisch, menschlich.
Luttwak würde hinzufügen: Diese Sackgasse ist keine zufällige Panne, sondern die logische Konsequenz paradoxer Strategielogik. Die eigentliche Tragödie liegt darin, dass dieser Zustand der Nicht-Entscheidung genau jener „tote Punkt“ ist, den van Creveld beschreibt. Weder Russlands Masse noch die ukrainische Kombination aus westlicher Technologie und eigener Tapferkeit können eine Entscheidung herbeiführen. Was bleibt, ist ein zermürbender Abnutzungskrieg, der erst endet, wenn eine Seite aus Erschöpfung nachgibt oder eine politische Lösung gefunden wird – militärisch ist keine Seite in der Lage, den Konflikt zu beenden.
Fazit: Die doppelte Bankrotterklärung
Van Crevelds historische Analyse und Luttwaks theoretische Konzeption der paradoxen Strategielogik ergänzen sich zu einer vernichtenden Diagnose der gegenwärtigen Lage. Van Creveld zeigt empirisch, wie moderne Kriegsführung an ihre Grenzen stößt; Luttwak erklärt theoretisch, warum lineare, rationale Planung in der Strategie systematisch scheitert.
Der Ukraine-Konflikt demonstriert beide Perspektiven in brutaler Klarheit:
- Van Crevelds Sackgasse: Technologische Überlegenheit ohne quantitative Basis ist wertlos. Nukleare Abschreckung verhindert direkte Großmachtkonflikte. Europas Deindustrialisierung macht konventionelle Kriegsführung unmöglich. Die mächtigsten Armeen können keine Entscheidungen mehr erzwingen.
- Luttwaks Paradoxie: Jede militärische Maßnahme erzeugt Gegenmaßnahmen. Erfolge schlagen an ihrem Höhepunkt in Misserfolge um. Mehr Unterstützung verlängert den Krieg, ohne ihn zu entscheiden. Abschreckung verhindert Einsatz. Rationale Planung führt zu irrationalen Ergebnissen.
Die Synthese beider Perspektiven ergibt ein düsteres Bild: Moderne Kriegsführung steckt nicht nur in einer militärischen Sackgasse (van Creveld), sondern in einer strategisch-logischen Paradoxie (Luttwak), aus der es keinen rationalen Ausweg gibt. Die eingangs beschriebene strukturelle Heuchelei – Kriegspropaganda durch Eliten, die selbst kein Risiko tragen – verschärft diese Lage noch, weil sie verhindert, dass die Unmöglichkeit militärischer Lösungen offen eingestanden wird.
Van Crevelds Analyse stellt das romantisierte oder heroische Bild des Krieges radikal infrage. Moderne Kriege werden zunehmend asymmetrisch, mit neuen Akteuren und ohne klare Trennung zwischen Kombattanten und Zivilisten. Krieg verliert seinen traditionellen Charakter und wird oft zum Selbstzweck. Die Einstellung und Motivation der Soldaten sowie die gesellschaftliche Haltung zum Krieg erweisen sich als entscheidende Faktoren – wichtiger oft als technologische Überlegenheit. Krieg ist kein heroisches Unternehmen, sondern ein brutales, komplexes und häufig irrationales Phänomen.
Luttwak fügt hinzu: Dieses Phänomen folgt einer paradoxen Logik, die rationales Planen und lineares Denken systematisch unterläuft. Die unbeabsichtigten Konsequenzen militärischer und politischer Handlungen offenbaren oft mehr über die eigentliche Logik des Konflikts als die ursprünglichen Absichten. Der Ukraine-Konflikt illustriert dies erschreckend: Keine der ursprünglichen Ziele wurde erreicht – weder russische „Entnazifizierung“, noch ukrainische Rückeroberung, noch westliche „strategische Niederlage“ Russlands. Stattdessen etablierte sich ein Zustand, den niemand wollte und aus dem niemand einen Ausweg weiß.
Der Ukraine-Konflikt fügt dieser doppelten Analyse eine weitere Dimension hinzu: Er enthüllt nicht nur das Scheitern technologischer Hybris und die paradoxe Natur strategischen Handelns, sondern auch die fundamentale Diskrepanz zwischen politischer Rhetorik und materieller Realität. Europas Unfähigkeit, der Ukraine ausreichend konventionelle Munition zu liefern, offenbart eine Deindustrialisierung der Verteidigungsfähigkeit, die Jahrzehnte systematischer Vernachlässigung reflektiert. Während man sich auf hochmoderne Waffensysteme konzentrierte, verlor man die Fähigkeit zur Massenproduktion jener profanen Materialien, die in einem intensiven konventionellen Krieg kriegsentscheidend sind.
Diese Einsichten bestätigen die fundamentale Kritik: Heutige Darstellungen von Krieg, die heroische Opferbereitschaft betonen, verschleiern systematisch die brutale Realität und die zerstörerischen sozialen und politischen Mechanismen. Sie machen Krieg zu einem elitären Projekt, bei dem die schlimmsten Folgen vor allem die einfachen Menschen tragen, während jene, die ihn konzipieren und propagieren, in sicherer Distanz verbleiben. Die Illusion technologischer Überlegenheit dient dabei als ideologische Legitimation für eine Praxis, die an ihren eigenen Widersprüchen scheitert – und deren moralische Bankrotterklärung gerade in diesem systematischen Scheitern sichtbar wird.
Der Ukraine-Konflikt führt vor Augen, dass van Crevelds Wendepunkt von 1945 bis heute nachwirkt: Atomare Abschreckung verhindert direkte Konfrontationen zwischen Großmächten, während konventionelle Kriege an logistischen, industriellen und gesellschaftlichen Grenzen scheitern. Luttwak würde ergänzen: Diese Grenzen sind nicht zufällig, sondern Ausdruck der paradoxen Natur von Strategie selbst, die sich gegen lineare Lösungsversuche sperrt.
Die Ukraine-Erfahrung offenbart dabei eine zusätzliche bittere Wahrheit: In der Moderne kann man mit ausreichender westlicher Unterstützung militärische Niederlagen hinauszögern, aber nicht mehr Siege erringen. Man kann verteidigen, aber nicht entscheiden. Man kann standhalten, aber nicht vorrücken. Dies ist vielleicht die düsterste gemeinsame Einsicht von van Creveld und Luttwak: Moderne Kriegsführung produziert keine Sieger mehr, sondern nur noch unterschiedlich stark Geschädigte in einem endlosen Abnutzungskonflikt, dessen Fortsetzung leichter ist als dessen Beendigung – und dessen paradoxe Logik dafür sorgt, dass jeder Versuch einer rationalen Lösung neue, unbeabsichtigte Probleme schafft.
Die vielleicht wichtigste Lehre aus der Verbindung beider Denker ist, dass moderne Kriegsführung nicht nur militärisch, sondern auch strategisch-logisch und moralisch in einer Sackgasse steckt – eine Sackgasse, die umso deutlicher wird, je lauter die militärische Rhetorik und je größer die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wer heute noch von militärischen Lösungen spricht, ignoriert nicht nur van Crevelds empirische Befunde, sondern auch Luttwaks theoretische Einsicht in die paradoxe, selbstzerstörerische Natur militärischen Handelns in der Moderne.
Quellenverzeichnis
Primärquellen (Buchliteratur)
van Creveld, Martin: Gesichter des Krieges – Der Wandel bewaffneter Konflikte von 1900 bis heute. München
Luttwak, Edward N.: The Logic of War and Peace. Cambridge, MA: Belknap Press
Sekundärquellen (Online-Artikel und Berichte)
Das Parlament: „Pro und Contra: Nato-Einladung an die Ukraine?“ URL: https://www.das-parlament.de/aussen/aussenpolitik/pro-und-contra-nato-einladung-an-die-ukraine (abgerufen November 2024)
TKP – Peter F. Mayer: „Debatte um NATO-Truppen in die Ukraine: Akt der Verzweiflung“, 27. Februar 2024. URL: https://tkp.at/2024/02/27/debatte-um-nato-truppen-in-die-ukraine-akt-der-verzweiflung/
World Socialist Web Site: „Nato bereitet direktes Eingreifen in den Russland-Ukraine-Krieg vor“, 29. Mai 2024. URL: https://www.wsws.org/de/articles/2024/05/29/pers-m29.html
ZDF: „Operationsplan: Was die Nato jetzt mit der Ukraine plant“, 13. Juni 2024. URL: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/nato-ramstein-gruppe-ukraine-krieg-russland-100.html
Pravda DE: „Stoltenberg schloss einen NATO-Konflikt mit Russland um die Ukraine aus“, November 2024. URL: https://deutsch.news-pravda.com/world/2025/11/09/509745.html
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: „Ukraine NATO – Ukraine EU-Beitritt – Wird Ukraine der NATO beitreten? – aktueller Stand 2025“. URL: https://www.lpb-bw.de/ukraine-eu-nato
Euronews: „Russland warnt Nato vor Truppeneinsatz in der Ukraine“, 27. Februar 2024. URL: https://de.euronews.com/2024/02/27/russland-warnt-nato-vor-truppeneinsatz-in-der-ukraine
Bundesministerium der Verteidigung: „Ukraine-Krieg: Wie reagiert die NATO?“, 9. März 2022. URL: https://www.bmvg.de/de/aktuelles/ukrainekrieg-wie-reagiert-die-nato-5367586
Bundeszentrale für politische Bildung: „NATO-Gipfel 2025 in Den Haag | Hintergrund aktuell“, 26. Juni 2025. URL: https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/563257/nato-gipfel-2025-in-den-haag/
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: „NATO Mitglieder – NATO Infos – NATO Gipfel 2025 – aktuelle NATO Treffen Beschlüsse“. URL: https://osteuropa.lpb-bw.de/nato-gipfeltreffen
Euronews/Euractiv: „EU verfehlt Munitionsziel für Ukraine – Borrell dennoch ‚zufrieden'“, 1. Februar 2024. URL: https://de.euronews.com/my-europe/2024/02/01/eu-verfehlt-munitionsziel-fur-ukraine-borrell-dennoch-zufrieden
ESUT (Europäische Sicherheit & Technik): Keller, André / Schröder, Germar: „Kapazitätsaufbau in der Verteidigungsindustrie am Beispiel Artilleriemunition“, 25. März 2024. URL: https://esut.de/2024/03/fachbeitraege/47822/kapazitaetsaufbau-in-der-verteidigungsindustrie-am-beispiel-artilleriemunition/
Euractiv DE: „Munitionsmangel: Tschechien fordert EU zum Kauf ausländischer Munition für Ukraine auf“, 5. Februar 2024. URL: https://www.euractiv.de/section/europa-kompakt/news/munitionsmangel-tschechien-fordert-eu-zum-kauf-auslaendischer-munition-fuer-ukraine-auf/
Strategy& (PWC): „Kapazitätsaufbau in der Verteidigungsindustrie am Beispiel Artilleriemunition“. URL: https://www.strategyand.pwc.com/de/de/branchen/luft-raumfahrt-verteidigung/kapazitaetsaufbau-verteidigungsindustrie.html
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: „Artilleriemunition Ukraine: Bedarf höher als die Liefermöglichkeiten“, 16. August 2024. URL: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/710596/dwn-interview-ukraine-bedarf-bei-intelligenter-artilleriemunition-hoeher-als-die-liefermoeglichkeiten
Euractiv DE: „Ukraine: Bisher nur 30 % der versprochenen EU-Artilleriemunition erhalten“, 27. Februar 2024. URL: https://euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/ukraine-bisher-nur-30-der-versprochenen-eu-artilleriemunition-erhalten
Euractiv DE: „Wie steht es um die EU-Munitionslieferungen an die Ukraine?“, 17. April 2024. URL: https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/wie-steht-es-um-das-eu-munitionslieferungen-an-die-ukraine/
Rat der Europäischen Union: „Gemeinsame Beschaffung von Munition und Flugkörpern durch die EU für die Ukraine: Rat vereinbart Unterstützung in Höhe von 1 Mrd. € im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität“, 5. Mai 2023. URL: https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2023/05/05/eu-joint-procurement-of-ammunition-and-missiles-for-ukraine-council-agrees-1-billion-support-under-the-european-peace-facility/
Deutscher BundeswehrVerband: „Nach sechs Monaten Krieg in der Ukraine: Munitionsbestand ‚unangenehm niedrig'“. URL: https://www.dbwv.de/aktuelle-themen/blickpunkt/beitrag/nach-sechs-monaten-krieg-in-der-ukraine-munitionsbestand-unangenehm-niedrig
ZDF: „Ukraine: Munitionsmangel könnte zu relevanten Schäden führen“, 19. April 2024. URL: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/munition-militaer-hilfe-ukraine-krieg-russland-100.html