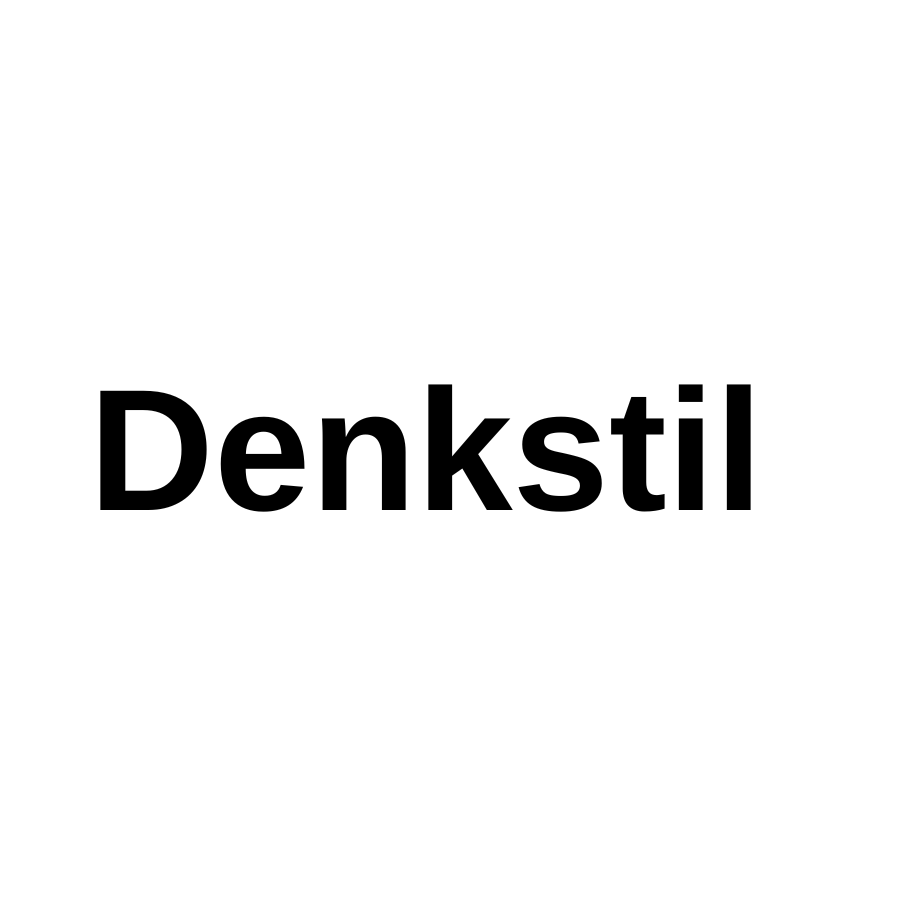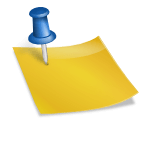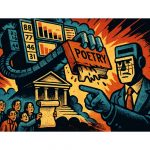In seinem provokanten Essay von 1998 dreht Holger Rust den Spieß um: Das neue Spießertum sitzt nicht mehr im Einfamilienhaus, sondern in den Redaktionsstuben, Hörsälen und Kulturzentren. Eine bittere Diagnose über die schleichende Verblödung der vermeintlich Gebildeten.
Es ist eine stille Revolution, die Holger Rust in seinem Werk „Die Revolution des Spießertums. Wenn Dummheit epidemisch wird“ beschrieben hat. Keine Barrikaden, keine Manifeste, keine politischen Umwälzungen – nur eine schleichende Mentalitätswende, die umso gefährlicher ist, weil sie von denen getragen wird, die sich selbst für aufgeklärt halten. Rust zeichnet das Bild einer Gesellschaft, in der ausgerechnet die gebildeten Milieus – Akademiker, Medienschaffende, das kulturinteressierte Bürgertum – zu Trägern eines neuen Spießertums geworden sind.
Was ist das für ein Spießer, der hier sein Unwesen treibt? Es ist nicht mehr der kleinbürgerliche Gartenzwergbesitzer vergangener Jahrzehnte. Der neue Spießer liest die richtigen Zeitungen, besucht Vernissagen, spricht über Diversity und Nachhaltigkeit. Doch hinter der progressiven Fassade verbirgt sich eine Haltung, die Rust als zutiefst reaktionär entlarvt: Die kompromisslose Verteidigung eigener Privilegien, getarnt als gesellschaftliches Engagement.
Der moderne Spießer, so Rust, hat charakteristische Züge entwickelt, die ihn von echter Aufklärung trennen. Er fällt schnelle Urteile und sucht einfache Schuldige, wo komplexe Zusammenhänge herrschen. Seine Rechthaberei erstickt jeden ernsthaften Diskurs. Statt selbstständig zu denken, passt er sich ideologischen Strömungen an und wiederholt Phrasen, die ihm soziale Anerkennung versprechen. Seine gesellschaftliche Haltung ist vor allem eines: Pose.
Mit einem literarischen Kunstgriff verdeutlicht Rust diese Problematik. Er greift auf Heinrich von Kleists „Über das Marionettentheater“ zurück, jene philosophische Parabel über Anmut und Bewusstsein. Wie die Figur bei Kleist, die versucht, eine natürliche Bewegung nachzuahmen und dabei gerade ihre Anmut verliert, so agiert der neue Spießer: Er imitiert kritisches Denken, ohne es zu verkörpern. Er spielt Aufgeklärtheit, ohne aufgeklärt zu sein. Das Ergebnis ist eine bizarre Mischung aus Selbstgewissheit und intellektueller Leere.
Rusts Gesellschaftskritik ist dabei von einer fast schmerzhaften Schärfe. Er diagnostiziert eine „epidemie-artige Verblödung“, die sich durch alle Lebensbereiche zieht. Modewahn und Oberflächlichkeit, die hohlen Rituale des Alltags, mediale Heuchelei und eine kulturelle Selbstzufriedenheit, die jede echte Auseinandersetzung erstickt – all das sind für ihn Symptome dieser schleichenden Revolution. In einer Reihe von Essays entfaltet er ein Panorama alltäglicher Selbsttäuschungen, das von der Konsumkultur über den Zynismus der Medien bis zur pseudo-intellektuellen Moral reicht.
Die eigentliche Provokation des Buches liegt in seiner Umkehrung des klassischen Spießer-Vorwurfs. Während traditionell das Kleinbürgertum mit seiner Engstirnigkeit und seinem Konformismus angeprangert wurde, richtet Rust seine Kritik gegen jene, die sich selbst als modern und kritisch begreifen. Die vermeintlich Progressiven, so seine These, haben das Spießertum nicht überwunden – sie haben es lediglich in neue, intellektuell verbrämte Formen gegossen. Die Revolution des Spießertums ist also keine Abschaffung der Spießigkeit, sondern ihre Metamorphose und ihr Aufstieg in höhere gesellschaftliche Sphären.
Rust, selbst Soziologe und Kulturforscher, will mit diesem Essay bewusst provozieren. Sein Ton ist polemisch, seine Diagnose bitter. Doch gerade in dieser Kompromisslosigkeit liegt die Stärke seiner Analyse. Er hält der Gesellschaft – insbesondere jenen Schichten, die sich gerne als ihre kritische Avantgarde verstehen – einen unbequemen Spiegel vor. Die Frage, die sein Werk aufwirft, hat nichts an Aktualität verloren: Sind wir wirklich so aufgeklärt, wie wir glauben? Oder haben wir nur gelernt, unsere Bequemlichkeit in die Sprache der Kritik zu kleiden?
„Die Revolution des Spießertums“ ist mehr als eine Zeitdiagnose der späten 1990er Jahre. Es ist eine Warnung vor der Selbstgefälligkeit intellektueller Milieus, vor der Gefahr, dass kritisches Denken zur bloßen Attitüde verkommt. In einer Zeit, in der öffentliche Debatten zunehmend von moralischen Posen und ideologischen Grabenkämpfen geprägt sind, erweist sich Rusts Analyse als erschreckend hellsichtig. Die Revolution des Spießertums ist vollendet – und die Spießer merken es nicht einmal.