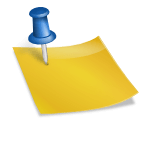Das Krisenmanagement der politischen Führung der EU der letzten Jahre erscheint vielen Beobachtern als ein schrittweiser Abbau demokratischer Prinzipien. Beschlüsse mit weitreichenden Konsequenzen für die Bevölkerung werden in überschaubaren Gremien getroffen, ohne dass die Wählerinnen und Wähler die Gelegenheit hätten, darüber abzustimmen. Tun sie es doch einmal, ist die Irritation auf den Märkten und in weiten Teilen der Medien groß.
Um so begrüßenswerter ist es daher, dass Jan-Werner Müller mit seinem Buch Das demokratische Zeitalter. Eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert einen Blick in die jüngere Vergangenheit gewährt, als sich die Demokratie unter heftigen Geburtswehen in Europa etablieren konnte.
Der Erste Weltkrieg stellt schlechterdings jede institutionelle Regelung und jede politische Idee – oder auch nur moralische Intuition in Frage, auf der das Zeitalter der Sicherheit beruht hatte. Die optimistische liberale Weltanschauung sollte sich davon nie wieder erholen. Ihr autoritärer Konkurrent jedoch erlitt einen noch größeren Vertrauensverlust: Mit Dynastizismus und Gottesgnadentum als glaubwürdigen Mitteln zur Legitimation politischer Herrschaft war es praktisch vorbei. Auch fegte der Krieg alle vier großen Kontinentalreiche hinweg: das Deutsche, das Habsburger-, dass Russische und das Osmanische Reich.
Im Jahr 1917 brach mit der russischen Revolution für viele Menschen ein neues Zeitalter an. Von Demokratie dem heutigen Verständnis nach konnte trotz der Betonung der proletarischen Kräfte keine Rede sein. In Deutschland versuchte die Weimarer Republik während der 20er Jahre das Volk mit der Demokratie vertraut zu machen. In Spanien und Portugal übernahmen Diktatoren die politische Führung. Mit dem Tod Francos sollte in Spanien erst 1976 ein demokratisches Zeitalter beginnen.
Wie Müller zeigt und wie es sich für einen Ideengeschichtler gehört, führten Ideologien und ihre Vordenker bei den politischen und militärischen Auseinandersetzungen im Hintergrund die Regie. So war Lenin eifrig bemüht, der Revolution ein theoretisch fundiertes Antlitz zu verleihen. Selbst Stalin wollte nicht gänzlich auf theoretische Überlegungen verzichten, um das Volk auf die Linie der Partei einzuschwören. Philosophen wie Georg Lukacs waren nur allzu gerne bereit, ihren Beitrag zur Aufklärung oder besser, Indoktrination der Massen zu leisten.
Aber auch der Faschismus machte ideologische Anleihen, wenngleich theoretisch weniger anspruchsvoll und, das mag auf den ersten Blick verwunderlich erscheinen, dabei nicht allzu wählerisch. In gewisser weise kurios, jedoch wenig überraschend, dass einige Denker, wie Georges Sorel, von beiden Seiten beansprucht wurden. Der Faschismus der Nationalsozialisten war zur Legitimation seines Handelns eher geneigt, auf staats- und verfassungsrechtliche Begründungen zurückzugreifen, die ein Carl Schmitt nur allzu bereitwillig lieferte.
Von theoretischem Ballast nicht so gedrückt wie der Leninismus und daher auslegungsfähig, kamen die Bedrohungen für den Faschismus aus einer anderen Richtung:
Wovor sich die Faschisten hingegen sehr wohl fürchteten, war, dass die Geschichte ihre Vorstellungen widerlegen könnte: Wahrheit war für sie eine Frage erfolgreichen politischen Handelns, eine Frage der Macht.
Der Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg führte in Westeuropa zur Einrichtung des Wohlfahrtsstaats, nicht zuletzt auch als Konsequenz aus den Erfahrungen der Vorkriegszeit wie auch von der Absicht geleitet, dem sozialistischen Modell einen humanen und sozialen Entwurf im Kapitalismus entgegenzusetzen.
In der Nachkriegszeit betrat mit der Christdemokratie eine neue politische Strömung die Bühne, die für Müller zur erfolg- und einflussreichsten der letzten Jahrzehnte wurde.
Zwei weitere für Müller einflussreiche Bewegungen nach 1945 waren die 68er und der Neoliberalismus. Deren zentrale Figuren wie Guy Debord/Herbert Marcuse und Friedrich August von Hayek standen den Gesellschaften der Wohlfahrtsstaaten wie überhaupt der parlamentarischen Demokratie von ihrem jeweiligen Standpunkt aus, kritisch bis ablehnend gegenüber. Als Zeichen der Ermutigung wertet es Müller daher, dass die Nachkriegsgesellschaft beide Ideologien überwunden hat.
Man muss dem Autor in seinen Analysen nicht in jedem Punkt zustimmen, um das Buch mit Gewinn zu lesen, zumal es, so weit ich sehen kann, der erste Versuch einer durchgängigen Ideengeschichte der Demokratie im 20. Jahrhundert ist.