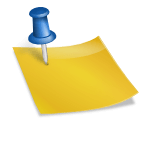In aller Kürze lässt sich sagen, dass die Soziobiologie, ausgehend vom Darwinistischen Paradigma, Verhaltensvarianten im Sinne einer Erblichkeit von Verhaltensmerkmalen erklärt. Grundlage sind, wie in der Ethologie, Verhaltensbeobachtungen, jedoch steht nicht die Beschreibung von Einzelindividuen im Mittelpunkt, sondern die Analyse von evolutivem Wandel. Bei der Untersuchung der evolutionären Funktion von Verhaltensweisen wird von einer gen-egoistischen Anpassung ausgegangen. Die klassische Verhaltensforschung konnte mit dem Bild egoistischen Fortpflanzungsverhaltens eines Individuums (‚survival of the fittest‘) nicht erklären, warum etwa dessen Fortpflanzung nicht unbegrenzt stattfindet, drastische Konflikte zwischen Individuen einer Art bestehen oder warum und unter welchen Umständen es zu Kooperationen kommt – alles Fragen, die von der Soziobiologie aufgegriffen wurden. Wilson beschrieb altruistisches Verhalten als zentrales Problem der Soziobiologie. In der soziobiologischen Theorie des egoistischen Gens (Dawkins) werden Individuen zu Vehikeln genetischer Reproduktionsstrategien. Damit lässt sich Altruismus als Programm egoistischer Gene erklären. Gene, deren Träger die individuellen Lebewesen sind, werden dadurch gleichsam zu Subjekten der Evolutionsgeschichte. Egoistische wie altruistische Verhaltensweisen können auf diese Weise als evolutionär wirksame Strategien mithilfe spieltheoretischer Modelle beschrieben werden.
Diese Kritik wiegt schwer, da die Soziobiologie ihre besondere, provokative Bedeutung gerade dadurch erlangt, dass sie die Entwicklung verschiedener Formen von Sozialverhalten als Evolution von Reproduktionsstrategien erklären will (5). Eine genetische Determination sei aber nicht belegbar (auch Wuketits spricht an solchen Stellen eher vorsichtig von ‚Disposition‘), sodass letztlich unklar ist, ob bzw. inwieweit sich Erbanlagen auf die kulturelle Evolution auswirken. Insgesamt bewertet Weber deshalb die eigentliche Kontroverse um die Soziobiologie als erloschen, nur „einige hitzköpfige Verteidiger und Kritiker“ würden noch die „Deutungsvormacht“ reklamieren (82).3 Fast liest es sich als Entwarnungsmeldung in Richtung Sozialwissenschaften: „In der Biologie konzentrieren sich die meisten Wissenschaftler auf das Studium von Tieren und meiden den Menschen als Untersuchungsobjekt“ (83). Weber macht unmissverständlich klar, „dass die Soziobiologie Wilson’scher Prägung ernsten und legitimen methodischen und konzeptuellen Kritiken ausgesetzt ist, die sich beim Studium des Menschen besonders deutlich zeigen“ (83). Auch Weiterentwicklungen unter den Bezeichnungen ‚Evolutionäre Psychologie‘ oder ‚Memetik‘ böten „oft nur plausibel klingende Geschichten als Erklärungen an, die kaum experimentellen oder vergleichenden Überprüfungen unterzogen werden können“ (93) – so lautet Webers abschließendes Urteil aus seiner Sicht als Biologe. Die Evolutionäre Psychologie sei infolgedessen – trotz „großer Beliebtheit auf dem Markt populärer Sachbücher“ (89) – wenig anerkannt in der akademischen Evolutionsbiologie. Aus geradezu sozialwissenschaftlicher Perspektive formuliert, gibt Weber abschließend zu bedenken: „Humansoziobiologie und Evolutionäre Psychologie versuchen zu zeigen, was angeblich die wahre, von einem kulturellen Überbau nicht verunreinigte Natur des Menschen ist. Dabei übersehen die Vertreter dieser Disziplinen nur allzu oft, dass Kultur und die Fähigkeit zum kulturellen Wandel ebenfalls ein fundamentales Element des menschlichen ‚Naturzustandes‘ ist“ (93).4
Den Diskursverläufen zur Soziobiologie in Wissenschaft und öffentlichen Medien geht Linke zunächst anhand von Häufigkeitsauszählungen in anerkannten wissenschaftlichen Zeitschriften und Pressedarstellungen nach (Kap. 4): Während die akademische Rezeption (insb. in Science) 1975 mit Wilsons Buch einsetzt und dann abebbt, sei der „deutsche Mediendiskurs zur Soziobiologie nicht parallel [verlaufen], sondern eher entgegen dem internationalen wissenschaftlichen Diskursverlauf“ (72). Ein ähnliches Bild zeigen die qualitativen Inhaltsanalysen der Diskussionen in wissenschaftlichen Zeitschriften (Kap. 5) und der Berichterstattung in deutschen „Leitmedien“ (Kap. 6). Auf dieser Grundlage kommt Linke zu dem Ergebnis, dass der internationale Wissenschaftsdiskurs zur Soziobiologie und deren Thematisierung in den deutschen Printmedien mit einer „Zeitverschiebung“ von 20 Jahren weitestgehend voneinander abgekoppelt verlaufen seien (Kap. 7, 8). Entgegen einer Zurückhaltung in den 1970er und 1980er Jahren, kam es ab 1990 zu einem Anstieg in der medialen Berichterstattung, die zur Jahrtausendwende einen Höhepunkt erreichte, während die Soziobiologie in Science und Nature kaum noch thematisiert wurde und in der deutschen Zeitschrift Naturwissenschaften im Grunde nie präsent war.7 Dabei ging es in der FAZ und im Spiegel zunehmend weniger um die Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse und Diskussionen. Stattdessen sei die Tendenz eines „laissez-faire im Umgang mit der Soziobiologie“ bei der Erklärung alltags- und kulturspezifischer Phänomene zu verzeichnen, auf eine „wissenschaftliche Kontextualisierung“ sei verstärkt verzichtet worden (193). Als Auslöser dieses eigendynamischen, lockeren Umgangs deutscher Medien mit naturalistischen Erklärungsmustern könne eine allgemein intensivierte und zumeist affirmative Berichterstattung von Bio- und Gentechnologien angesehen werden. Linke resümiert, dass es „gegen Ende der 1990er Jahre ‚auf dem Rücken‘ der Biotechnologie“ zur medialen Konjunktur der Soziobiologie gekommen sei (203).
Ist nicht die alte Anlage-Umwelt-Debatte gerade deshalb unfruchtbar, weil jeweils mit Universalanspruch entweder einem naturalistischen oder kulturalistischen Erklärungsansatz ein Primat zugesprochen wird? Sachverhalte, die unter ‚Kultur‘ gefasst werden (insb. gesellschaftliche Makrostrukturen), können nicht auf Biologie reduziert werden, genauso wie biologische von physikalischchemischen Erscheinungen als irreduzibel unterschieden werden. Als Schlussfolgerung ließe sich ziehen: Einem ontologischen Monismus, wie dem von der Soziobiologie vertretenden Universalprinzip der Evolution, ist ein methodologischer Pluralismus vorzuziehen, weil auf diese Weise die jeweiligen Erkenntnisgrenzen biologischer wie sozialwissenschaftlicher Forschung nicht ignoriert, sondern explizit in Rechnung gestellt werden können (vgl. Seifert 2003). Biologie und Soziologie würden so nicht länger als Konkurrenzunternehmungen angesehen werden, sondern als anders ausgerichtete Forschungsmethoden auf unterschiedlichen Analyseebenen, die sich, wo sie sich berühren, gegenseitig befruchten könnten (vgl. Vowinckel 1991)