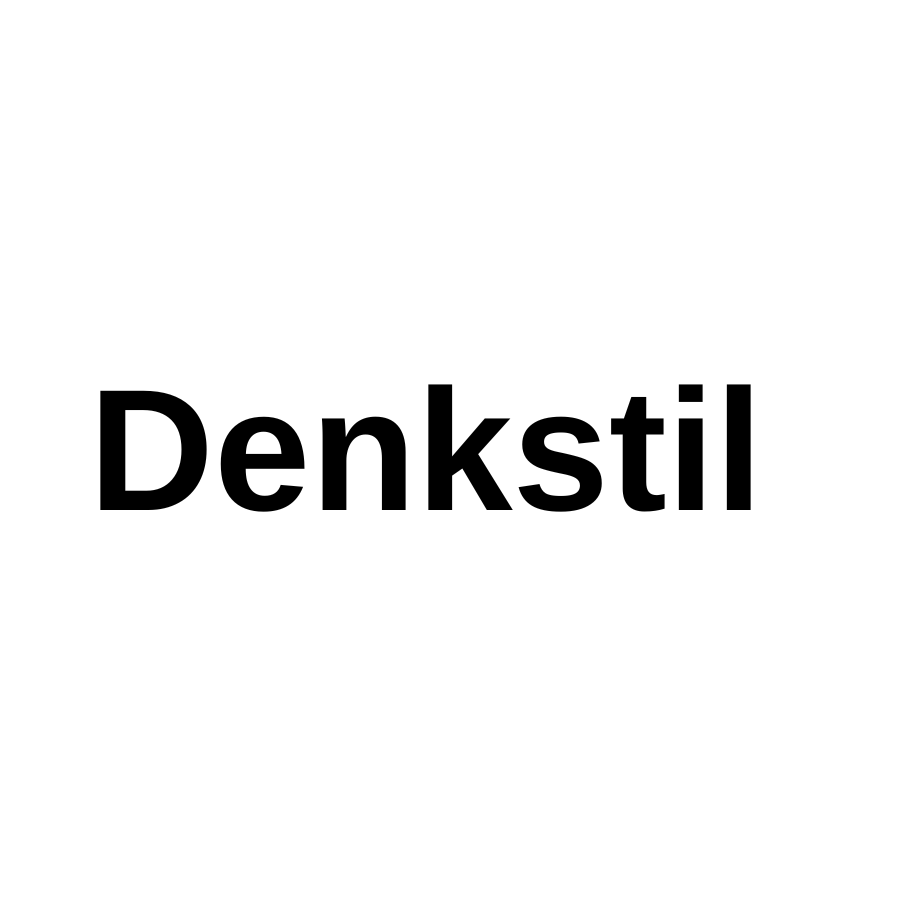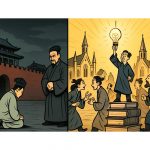Während Europa seinen jahrhundertelangen Status als politisches und wirtschaftliches Zentrum der Welt zu verlieren scheint, zeigt ein Blick auf soziologische Theorien und historische Beispiele: Die Peripherie war schon immer der Ort, von dem aus die großen Erneuerungen ihren Ausgang nahmen. Ein Essay über die schöpferische Kraft des Randes und warum Europas Peripherisierung eine Chance sein könnte.
Die Angst vor dem Abstieg beherrscht derzeit die europäische Debatte. China überholt wirtschaftlich, die USA dominieren technologisch, und Europa scheint zum Zuschauer der Weltgeschichte zu werden. Doch was, wenn diese Sorge auf einem grundlegenden Missverständnis beruht? Was, wenn die Bewegung vom Zentrum zur Peripherie nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen kreativen Phase bedeutet?
Die Systemtheorie der Transformation
Der Soziologe Niklas Luhmann bietet einen radikalen Perspektivenwechsel auf diese Frage. Aus seiner systemtheoretischen Sicht sind gesellschaftliche Veränderungen – einschließlich der Verschiebung einer Region vom Zentrum zur Peripherie – zunächst einmal **Beobachtungen, keine Katastrophen**. Luhmanns Ansatz hebt die Eigenlogik sozialer Systeme hervor, die sich unabhängig von moralischer Bewertung oder politischen Zielsetzungen entwickeln können.
Für Luhmann steht nicht die messbare Distanz zwischen Mitte und Rand im Vordergrund, sondern die **Anschlussfähigkeit und Komplexität der Kommunikation**. Entscheidend ist die Fähigkeit, von interaktionsabhängigen zu kommunikationsbasierten Systemen überzugehen. Distanz vom Zentrum wird nur dann zum Nachteil, wenn dieser Übergang nicht gelingt. Europa mit seiner hochentwickelten, jedenfalls noch in groben Zügen vorhandenen Kommunikationsinfrastruktur und seinen dichten Netzwerken könnte gerade von dieser Transformation profitieren.
Das historische Paradox der kreativen Peripherie
Ein Blick in die Geschichte offenbart ein bemerkenswertes Muster: Die großen geistigen und kulturellen Umbrüche entstehen selten in den etablierten Machtzentren. Die Reformation, jene gewaltige Bewegung, die Europa grundlegend veränderte, nahm nicht ihren Ausgang vom gelehrten Paris, dem glänzenden Rom oder dem weltbeherrschenden Madrid, sondern von der bescheidenen, erst kürzlich gegründeten Universität Wittenberg.
Diese „sonderbare historische Tatsache“ – dass es fast immer die Peripherie ist, die neue schöpferische Kräfte entbindet – lässt sich durch die Geschichte verfolgen: Das Christentum entstand in einer verachteten kleinen Provinz des römischen Weltreichs, der mosaische Monotheismus trat fern von den großen orientalischen Metropolen ans Licht, und der Islam begann seinen Siegeslauf in der arabischen Wüste.
Jenseits der Geographie: Neue Raumkonzepte
Moderne Denkansätze fordern uns auf, die traditionelle Zentrum-Peripherie-Logik grundlegend zu überdenken. Der Staatsrechtler Carl Schmitt erkannte bereits 1941, dass **Grenzen keine Linien auf Landkarten sind**. Peripherien können als „Leistungsräume“ verstanden werden, die aus spezifischen Operationen, Techniken und Praktiken hervorgehen. Nicht die Dinge werden in einem kartesischen Raum platziert, sondern sie bringen als Akteure kollaborativ einen spezifischen Raum hervor.
Noch radikaler denkt der Philosoph Édouard Glissant mit seinem **archipelischen Denken**. Für ihn ist die Insel eine Metapher für die Neuformulierung unseres Raumdenkens – sie steht für das Verständnis von Raum als etwas Grenzenlosem. Die Insel ist keine isolierte Einheit, sondern streckt sich unbegrenzt in verschiedene Beziehungsrichtungen aus, während sie sich gleichzeitig zur Selbsterkenntnis nach innen kehrt. Dies ist die Fähigkeit, sich seiner Verbindung zu etwas wesentlich Größerem bewusst zu sein – der Beziehung zu einem ganzen Archipel.
Europa als kreative Insel
Übertragen auf Europa bedeutet dies: Die scheinbare Peripherisierung könnte Europa die Chance eröffnen, sich von den Zwängen der Weltmachtkonkurrenz zu befreien und neue Formen des Zusammenlebens, des Wirtschaftens und der kulturellen Entwicklung zu erproben. Wie die großen peripheren Bewegungen der Geschichte könnte Europa gerade aus seiner vermeintlichen Schwäche heraus innovative Lösungen für globale Herausforderungen entwickeln.
Die europäische Tradition der Aufklärung, des kritischen Denkens und der sozialen Innovation muss nicht im Zentrum der Weltmacht stehen, um wirksam zu sein. Im Gegenteil: Befreit vom Druck, als Supermacht zu agieren, könnte Europa zu einem **Labor für nachhaltige Gesellschaftsmodelle** werden – ein Archipel kreativer Experimente, das seine Wirkung nicht durch Macht, sondern durch die Überzeugungskraft seiner Ideen entfaltet.
Die Chance der Transformation
Europa steht möglicherweise nicht vor einem Abstieg, sondern vor einer fundamentalen Neupositionierung. Die Peripherie war schon immer der Ort der Erneuerung, der Ort, an dem neue Ideen entstehen, weil der Druck der etablierten Ordnung geringer ist. Europa könnte diese historische Gesetzmäßigkeit für sich nutzen und aus der vermeintlichen Schwäche eine neue Stärke entwickeln.
Die Frage ist nicht, ob Europa zur Peripherie wird, sondern wie es diese Transformation gestaltet. Wird es sich als gescheiterte Weltmacht verstehen oder als Vorreiter einer neuen Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens? Die Geschichte lehrt uns: Jede Avantgarde kommt aus der Peripherie. Europas Zeit als kreative Peripherie könnte gerade erst beginnen.
Quellen:
Zur Differenz von Zentrum und Peripherie
Die schöpferische Peripherie (Egon Friedell)