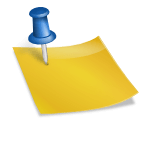Von Ralf Keuper
Mit Blick auf das Scheitern der ersten deutschen Demokratie werden derzeit gerne Parallelen zur aktuellen politischen Entwicklung gezogen. Erneut stehe die Demokratie – nicht nicht nur Deutschland – vor einer Bewährungsprobe. Als größte Bedrohungen gelten die Wahlerfolge von Parteien am rechten Rand sowie das schwindende Vertrauen in die Eliten und Institutionen. Eine weitere Parallele ist für viele Kommentatoren die Verrohung der Sprache.
All das lasse jedoch nach Ansicht einiger Historiker nicht den Schluss zu, dass sich die Ereignisse von 1918 bis 1933 vor unseren Augen erneut abspielen. Die Geschichte wiederholt sich nicht. Die Erklärungskraft von Analogien kommt hier rasch an ihre Grenzen. Schnell betreibt man das Geschäft des Historizismus.
In seinem Buch Kaisersturz geht Lothar Machtan auf die Parallelen des Untergangs der deutschen Monarchie im November 1918 mit der heutigen Situation ein:
Was an den politischen Vorgängen, die zum 9. November führten, ist mit Blick auf den politischen Diskurs von heute besonders erinnerungswürdig? … Auch heute sind die Protagonisten des etablierten Politikbetriebs verunsichert. Sie spüren, dass die Politik ganz neue Antworten braucht auf die Fragen, die die rasanten Veränderungen unserer Welt aufwerfen. Zumal niemand behaupten kann, dass die operative Politik, wie wir sie in den letzten zehn Jahren erlebt haben, konzeptionell gut durchdacht gewesen sei. Und immer noch wird zu viel Zeit mit Passivität und Ankündigungs-Rhetorik vertan, statt konkrete Lösungsmodelle durchzuspielen und große öffentliche Debatten zu initiieren.
Allerdings:
Die etablierte Welt stürzt voran, doch wahrscheinlich nicht in den Abgrund; denn schließlich werden wir durch das, was jetzt (ver)schwindet, eher reicher als ärmer. So richtig schlecht ist es um die Substanz jedenfalls der westlichen Demokratie wohl nicht bestellt. Denn ob sich unsere Gesellschaft in ihrer großen Freiheit, die sie bis heute besitzt, noch einmal beschneiden lässt, ist unwahrscheinlich. Steht doch die demokratische Lebensform als zivilisatorische Errungenschaft für die übergroße Mehrheit unserer Gesellschaft außer Frage. Wie sind deshalb gut beraten, der sich unter unseren Augen vollziehenden Umbruchphase einen anderen historischen Sinn abzugewinnen als den einer auffälligen Übereinstimmung mit der Signatur jener Zeit, die dem Epochenwechsel von 1918 eingeschrieben war.
Weiterhin:
Digitaler Kapitalismus und Neonationalismus beschwören wesentlich andere Gefahren herauf, als dies der autoritäre Monarchismus des deutschen Kaiserreichs mit seiner Bereitschaft zum Weltkrieg getan hat. Als Projektionsfläche zeitgenössischer politischer Sinnsuche ist dieser „deutsche Herbst“ denkbar ungeeignet. Insofern sollten wir der damaligen Zeitenwende ihre Einzigartigkeit lassen.
Nah an dieser Position bewegt sich der Historiker Jörn Leonhard. Angesprochen auf die Erfolge der AfD und die zunehmende rechtsextreme Gewalt, die von vielen Kommentaren als Vorboten neuer Weimarer Verhältnisse interpretiert werden, antwortete Leonhard in einem Interview:
Wer heute vor „Weimarer Verhältnissen“ warnt, dem ist Aufmerksamkeit gewiss. Tatsächlich sind wir aber bei allen Veränderungen weit von „Weimarer Verhältnissen“ entfernt: Es gibt in Berlin keine offenen Straßenschlachten zwischen Teilen der extremen Rechten und extremen Linken, wir haben keine Massenverelendung großer Teile der Gesellschaft. Genauso wenig ist der Mittelstand durch Hyperinflation und Wirtschaftskrise ruiniert, dazu hat Deutschland keine schwerwiegenden territorialen Konflikte mit seinen Nachbarstaaten.
Außerdem:
.. dass es ruppiger und ungemütlicher wird, bedeutet nicht automatisch eine Krise der Demokratie, ein Versagen demokratischer Institutionen, gar eine Staatskrise. …
Wir können die Entscheidung, wie wir uns heute politisch verhalten, auch nicht an die Geschichte delegieren. Aber wir brauchen Analogien, um zu erkennen, worin sich Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden. Beim Blick auf die Geschichte wird man bei vielen heutigen Entwicklungen wesentlich nüchterner, weniger alarmistisch urteilen. Und das ist genau das, was uns augenblicklich Not tut: Nicht mit unzulässigen Analogien eine Existenzkrise der Demokratie herbeireden, die es trotz aller Belastungen und Konflikte so noch nicht gibt.