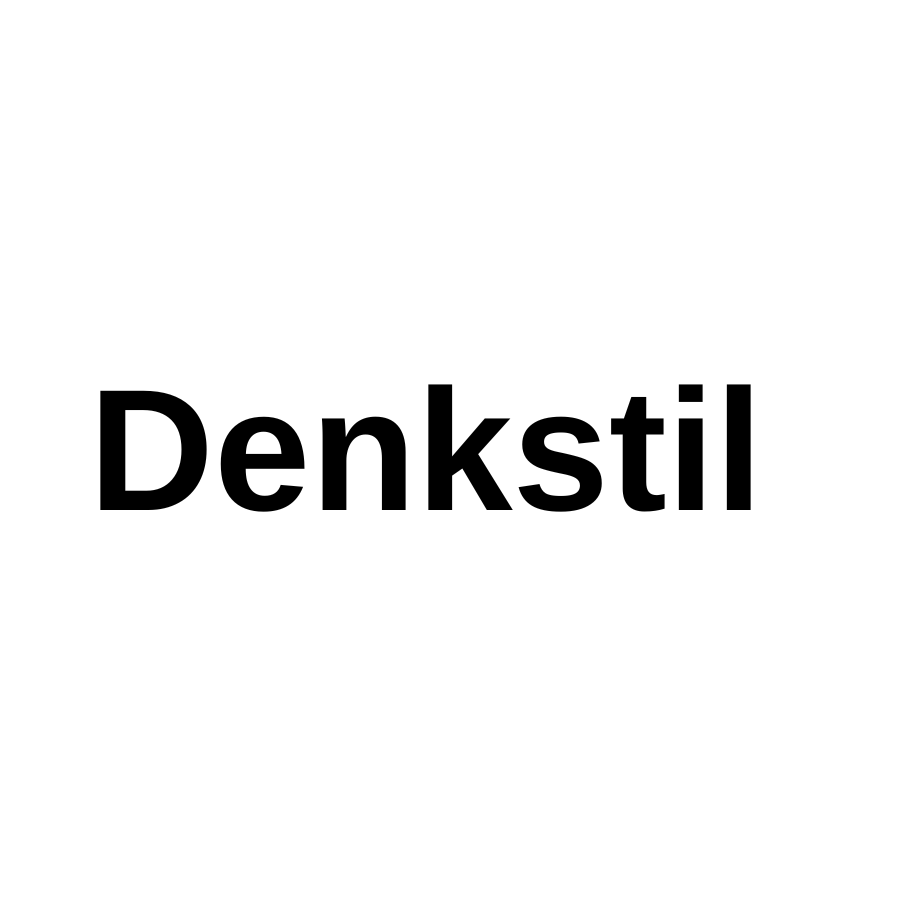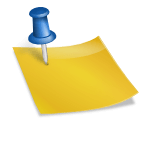Die protestantische Frömmigkeit betont das individuelle Gewissen und befreit vom rituellen Korsett kirchlicher Institutionen. Doch diese Freiheit hat ihren Preis: Ohne sakramentale Entlastung werden Protestanten anfällig für weltliche Heilsversprechen. Von der Vergötterung nationaler Bewegungen bis zur unkritischen Feier von Greta Thunberg – die Geschichte zeigt ein Muster der Unterwerfung unter den jeweiligen Zeitgeist.
Die Zerrissenheit des protestantischen Subjekts
Wer vom Protestantismus spricht, meint zunächst eine Befreiung: Die Ablehnung päpstlicher Autorität, die Unmittelbarkeit zu Gott, die Gewissensentscheidung des Einzelnen. Doch diese Emanzipation von institutioneller Bevormundung schafft eine charakteristische Gefährdung. Der Protestant steht nackt vor seinem Gott – ohne die rituellen Geländer, die den Katholiken stützen, ohne sakramentale Entlastung durch eine starke Institution.
Diese existenzielle Einsamkeit prägt eine spezifische Persönlichkeitsstruktur: widersprüchlich, zerrissen, oszillierend zwischen euphorischer Gewissheit und abgründiger Verzweiflung. „Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt“ – beides nicht trotz, sondern wegen des extrem hohen religiös-moralischen Anspruchs, den der Protestantismus an das Individuum stellt. Der institutionendefinierte Katholik mag unfrei sein, dafür aber innerlich stabilisiert durch kollektive Rituale und kirchliche Ordnung.
Die Suche nach dem Ersatz-Papst
Paradoxerweise führt die Verweigerung gegenüber der päpstlichen Autorität nicht zur dauerhaften Autonomie, sondern zur Suche nach Ersatz. Protestanten standen historisch in der permanenten Gefahr, weltlichen Autoritäten jenen religiösen Kredit zu geben, den sie Rom einst verweigert hatten. Der König, die Nation, der Staat – sie alle konnten in diese Leerstelle einrücken und eine quasi-sakrale Verehrung erfahren.
Dies erklärt, warum gerade protestantische Intellektuelle ungleich bereiter waren als ihre katholischen Kollegen, reformatorische Überlieferung mit modernen Ideen zu verbinden. Die deutschen Nationalismen des 19. und 20. Jahrhunderts wurden primär mit protestantischen Integrationsmustern konstruiert. Die Hoffnung: Auch die Katholiken ließen sich langfristig in die deutsch-protestantische Gemeinschaft einbinden. Das Ergebnis kennen wir aus der Geschichte – eine fatale Staatsgläubigkeit, die im Nationalsozialismus ihren Tiefpunkt fand.
Der neue Zeitgeist: Von Luther zu Greta
Diese strukturelle Anfälligkeit besteht fort. In den jüngeren Debatten um Greta Thunberg lässt sich das alte Muster in neuem Gewand beobachten. Vertreter der evangelischen Kirche feierten die Klimaaktivistin beinahe heroisch, als prophetische Stimme, als moralische Instanz. Doch diese Glorifizierung entspringt keiner theologischen Fundamentierung, sondern der Anpassung an den gegenwärtigen gesellschaftlichen Mainstream.
Thunberg selbst beruft sich nicht auf Gott oder kirchliche Autorität, sondern auf Wissenschaft und Moral. Dennoch – oder gerade deshalb – wird bzw. wurde sie von protestantischen Kreisen in einen quasi-religiösen Kontext gestellt. Hier zeigt sich die Gefahr in Reinform: Die protestantische Geistlichkeit schließt sich modischen Positionen an, gibt dem Zeitgeist nach, verwechselt gesellschaftliche Trends mit göttlichem Auftrag.
Das fehlende Korrektiv
Was dem Protestantismus fehlt, ist nicht Gewissensernst oder moralischer Anspruch – davon gibt es eher ein Übermaß. Was fehlt, ist die institutionelle Distanz, die starke Kirche als Korrektiv gegen zeitgeistige Vereinnahmungen. Der Katholizismus mag autoritär, starr und reformresistent sein. Aber diese vermeintlichen Schwächen schützen ihn paradoxerweise vor der bedingungslosen Unterwerfung unter wechselnde weltliche Ideologien.
Der Protestant hingegen, zurückgeworfen auf die eigene Subjektivität, bleibt anfällig für die Sirenengesänge der jeweiligen Epoche. Seine Flexibilität ist zugleich seine Schwäche. Seine Offenheit für gesellschaftliche Modernisierung kann in kritiklose Anpassung umschlagen. Der hohe Anspruch an sich selbst wird zur Quelle innerer Instabilität, wenn keine feste institutionelle Struktur ihn trägt.
So bleibt die protestantische Persönlichkeit: innerlich widersprüchlicher, psychisch labiler, aber auch offener für Veränderung. Eine Religiosität voller Chancen und Risiken – deren größte Gefahr vielleicht darin besteht, die weltliche Macht mit jener Absolutheit zu verehren, die sie einst dem Papst verweigerte.
Quelle:
Protestantische Frömmigkeit birgt in allem Gewissensernst spezifische Gefährdungspotenziale