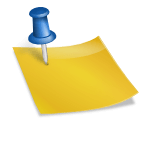Im Jahr 1933, als sich totalitäre Systeme anschickten, den Menschen im Kollektiv verschwinden zu lassen, veröffentlichte der junge Peter Drucker einen Essay über Søren Kierkegaard. Die Schrift war eine intellektuelle Kampfansage gegen den Zeitgeist – und blieb es. Was kann uns ein Text über einen dänischen Philosophen des 19. Jahrhunderts heute noch sagen? Mehr, als man vermuten würde.
I.
Es gibt Texte, die ihre Bedeutung erst im Rückblick offenbaren. Peter Druckers Essay „Der unmodische Kierkegaard“ aus dem Jahr 1933 gehört zu dieser Kategorie. Was auf den ersten Blick als philosophiehistorische Würdigung eines Außenseiters erscheint, erweist sich bei näherer Betrachtung als programmatische Schrift – eine Absage an die Heilsversprechen seiner Zeit.
Drucker war 24 Jahre alt, als er diesen Text verfasste. In Deutschland war Hitler an die Macht gekommen, in der Sowjetunion konsolidierte Stalin seinen Terror. Beide Systeme teilten eine Grundüberzeugung: Der einzelne Mensch ist bedeutungslos; nur das Kollektiv – Volk, Klasse, Partei – verdient Aufmerksamkeit. Der Individualismus galt als bürgerliches Relikt, das der Geschichte zum Opfer fallen würde.
In diese Situation hinein schrieb Drucker über einen Denker, der genau das Gegenteil behauptet hatte: dass nämlich die menschliche Existenz nur als individuelle denkbar sei und dass alle Versuche, sie im Sozialen aufzulösen, in Verzweiflung enden müssten.
II.
Die zentrale Frage, die Drucker bei Kierkegaard findet, lautet nicht: Wie ist Gesellschaft möglich? Diese Frage hatte das 19. Jahrhundert in allen Varianten durchdekliniert – von Hegels Weltgeist über Marx‘ Klassenkampf bis zu Comtes Positivismus. Die Antworten differierten, die Fragerichtung blieb dieselbe: Der Mensch war Funktion des Sozialen.
Kierkegaard stellte die Gegenfrage: Wie ist menschliche Existenz möglich? Diese Umkehrung war mehr als ein philosophischer Kunstgriff. Sie war eine Absage an den Optimismus des Jahrhunderts, der davon ausging, dass die Menschheit durch Fortschritt zur Vollendung gelangen könne – dass also die Ewigkeit durch die Zeit erreichbar sei.
Für Kierkegaard war dies eine Illusion. Die menschliche Existenz vollzieht sich in einer unauflösbaren Spannung: zwischen dem individuellen Geist und dem Leben in der Gesellschaft, zwischen Ewigkeit und Zeit. Diese Spannung lässt sich nicht durch Fortschritt überwinden, nicht durch Revolution aufheben, nicht durch Wissenschaft auflösen. Sie ist die Grundstruktur des Menschseins.
III.
Was folgt daraus? Zunächst einmal Angst. Die Angst ist bei Kierkegaard kein pathologischer Zustand, sondern die angemessene Reaktion auf die Situation des Menschen, der zwischen zwei Dimensionen existiert, ohne in einer von ihnen aufgehen zu können. Der Mensch kann weder reiner Geist werden noch sich ganz in der Gesellschaft verlieren – jedenfalls nicht ohne den Preis der Verzweiflung.
Drucker erkennt in dieser Diagnose die Aktualität Kierkegaards. Denn genau das war es, was die totalitären Bewegungen seiner Zeit versprachen: die Erlösung von der Spannung. Im Aufgehen im Kollektiv sollte der Einzelne von der Last seiner Individualität befreit werden. Die Angst vor der Existenz würde weichen, sobald man sich dem Ganzen überantwortet hätte.
Kierkegaard hätte dies als Flucht in die Verzweiflung erkannt – als den Versuch, die Spannung zu leugnen statt sie auszuhalten. Und Drucker folgte ihm darin. Die Verleugnung des Individuums führt nicht zur Befreiung, sondern zur tiefsten Form der Unfreiheit.
IV.
Der Titel des Essays ist programmatisch: „Unmodisch“ zu sein wird zur intellektuellen Auszeichnung. Kierkegaard war unmodisch, weil er sich der Hegelianischen Synthese verweigerte, in der das Besondere im Allgemeinen aufgehoben wird. Er bestand auf dem Einzelnen – nicht als Durchgangsstation zum Ganzen, sondern als irreduzible Wirklichkeit.
Diese Unmodischkeit machte ihn für Drucker 1933 so relevant. Denn die Moderne hatte unterdessen die Hegelianische Synthese in zwei politische Varianten gegossen: die faschistische und die kommunistische. Beide versprachen, die Entfremdung des modernen Menschen zu überwinden, indem sie ihn in ein größeres Ganzes eingliederten. Beide scheiterten an demselben Irrtum: an der Annahme, dass die Spannung der Existenz eine Störung sei, die behoben werden könne.
V.
Druckers späteres Werk als Management-Theoretiker wird oft ohne Bezug zu seinen frühen philosophischen Schriften gelesen. Das ist ein Fehler. Denn die Grundfrage bleibt dieselbe: Wie kann der Mensch in Organisationen existieren, ohne in ihnen aufzugehen? Wie lässt sich verhindern, dass er zur bloßen Funktion wird?
Die Antwort, die Drucker über Jahrzehnte hinweg variierte, wurzelt in der Kierkegaard-Lektüre von 1933: durch die Anerkennung der Spannung. Organisation und Individuum stehen in einem Verhältnis, das sich nicht harmonisieren lässt. Der Versuch, den Menschen vollständig in die Organisation zu integrieren, führt zu derselben Verzweiflung wie der Versuch, ihn im politischen Kollektiv aufzulösen.
Was Drucker später „Management“ nannte, war im Kern der Versuch, diese Spannung produktiv zu gestalten – nicht sie zu beseitigen. Der Manager als derjenige, der zwischen den Anforderungen der Organisation und der Würde des Einzelnen vermittelt: Das ist eine säkularisierte Version dessen, was Kierkegaard mit dem „Sprung in den Glauben“ gemeint hatte.
VI.
Warum ist das heute noch relevant? Weil die Versuchung, die Spannung aufzulösen, nicht verschwunden ist. Sie hat nur die Form gewechselt.
Die algorithmische Steuerung verspricht, menschliche Entscheidungen durch Daten zu ersetzen. Die Plattformökonomie behandelt Menschen als Aggregate von Verhaltensmustern. Die künstliche Intelligenz wird als Werkzeug verstanden, das den Menschen von der Last seiner Urteilskraft befreien soll.
In all diesen Entwicklungen kehrt die Grundfigur wieder, die Kierkegaard analysiert und Drucker 1933 aktualisiert hat: die Flucht vor der Spannung der Existenz in Systeme, die versprechen, sie aufzuheben. Dass diese Systeme heute nicht mehr „Volk“ oder „Klasse“ heißen, sondern „Algorithmus“ oder „Plattform“, ändert an der Struktur wenig.
VII.
Der unmodische Kierkegaard bleibt unmodisch. Seine Botschaft – dass die menschliche Existenz nur in der Spannung möglich ist und dass alle Versuche, diese Spannung aufzulösen, in Verzweiflung enden – passt in keine Zeit, die nach Lösungen sucht.
Aber vielleicht ist genau das der Punkt. Drucker verstand 1933, dass die Unmodischkeit Kierkegaards keine Schwäche war, sondern seine Stärke. Denn wer den Versprechen seiner Zeit misstraut, hat bessere Chancen, die Wirklichkeit zu erkennen.
Die menschliche Existenz ist nicht optimierbar. Sie ist auch nicht ins Kollektiv auflösbar. Sie ist und bleibt das, was Kierkegaard beschrieben hat: eine Spannung, die ausgehalten werden muss. Wer das akzeptiert, hat einen Begriff von Würde, der gegen alle Zugriffe gefeit ist – seien sie politischer, ökonomischer oder technologischer Natur.
Das ist keine tröstliche Botschaft. Aber es ist eine wahre.