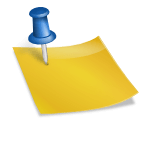Die Fortschritte in der Verarbeitung und Aufbereitung großer Datenmengen, wie sie in letzter Zeit für Schlagzeilen sorgen und nur selten ohne die Begriffe „Big Data“ und „In-Memory“ auskommen, haben bei einigen Kommentatoren einen Enthusiasmus ausgelöst, der einer kritischen Analyse bedarf. Zu fragen ist daher, ob und in welchem Umfang die Möglichkeiten größere Datenmengen als bisher verarbeiten zu können, die Qualität der Informationen verbessert haben. Häufig entsteht nämlich der Eindruck, dass Quantität mit Qualität verwechselt wird.
So kann Stephen Few auch nur mühsam seine Abneigung gegen rein Marketing-getriebene Aussagen und Versprechungen verbergen, die, wieder einmal, ein neues Zeitalter heraufdämmern sehen, in dem es nun den Unternehmen endlich möglich ist, das Datenmeer so zu filtern, dass die Entscheidungsqualität und damit natürlich auch der Umsatz sowie der Profit in ungeahnte Höhen schnellen.
Wie so oft, so sieht auch hier die Realität deutlich nüchterner aus. Das Problem bei der Bewältigung großer Datenmengen liegt weniger in der Technologie als vielmehr im kognitiven Bereich, d.h. in den Methoden und Verfahren, die nötig sind, um daraus wirklich relevante Informationen gewinnen zu können. Hierfür ist es nötig, Kriterien für die Güte der Informationen zu definieren, da ansonsten der Eindruck entsteht, alle Information sei gleichwertig und der tiefergehenden Analyse würdig. Anderenfalls haben wir es nur mit „Mehr vom Gleichen“ zu tun, d.h. eine deutlich höhere Quantität, bei gleichbleibender Qualität.
In seinem Artikel Big Data, Big Ruse formuliert Stephen Few einige Fragen, auf die neue Technologien zur Informationsverarbeitung, wie sie unter dem Begriff Business Intelligence zusammengefasst werden, befriedigende Antworten liefern müssen, soll ihr Einsatz gerechtfertigt sein.
Unterstützung für Stephen Few´s Anforderungskatalog findet sich auch bei Carl-Friedrich von Weizsäcker, der Informationen wie folgt klassifiziert:
- Die >syntaktische< Dimension umfasst die Beziehung der Zeichen zueinander;
- die >semantische< Dimension umfasst die Beziehung der Zeichen untereinander und das, wofür sie stehen;
- die >pragmatische< Dimension umfasst die Beziehung der Zeichen untereinander, das, wofür sie stehen, und das, was dies für den beteiligten Sender und Empfänger als Handlungsforderung darstellt.
Für uns ist vor allem die pragmatische Dimension der Information entscheidend.
Oder in den Worten von Gregory Bateson:
Was wir tatsächlich mit Information meinen, ist ein >Unterschied, der einen Unterschied ausmacht<. ..
In dem Kapitel Irreversibilität und die Entstehung von Information aus ihrem Buch Das Spiel – Naturgesetzte steuern den Zufall schreiben Manfred Eigen und Ruth Winkler:
Eine Nachricht, die man empfängt, soll verstanden werden. Dazu muss sie ihren Sinn >offenbaren<, das heißt an gewisse existierende Erfahrungen oder Vereinbarungen anknüpfen und diese reproduzieren. Gleichzeitig kann sie jedoch auch unsere Erfahrungen bereichern. Das Herstellen von Zusammenhängen, das Eindordnen, das Verstehen ist dann zugleich ein Akt der Schöpfung. … Die >neue< Information verdankt ihren Ursprung einem nicht umkehrbaren Ereignis, sie geht aus einer >Sinnbewertung< – denn das ist Selektion schließlich – hervor. Man könnte auch mit Karl Popper sagen: Gewisse, vorher noch mögliche Alternativen werden falsifiziert. Im Falle einer Beobachtung oder beim Lesen einer Nachricht muss ein analoger Prozess im Gehirn ablaufen.
Das ist m.E. die brauchbarste Definition von Information, die sich auch im betrieblichen Alltag verwenden lässt. Relevante Informationen müssen sich in den bestehenden Kontext einordnen und in einen weiteren Zusammenhang bringen lassen oder aber diesen infrage stellen und zu neuen Fragen und Informationssuche animieren. Informationen, die einen bestehenden Status quo lediglich bestätigen und damit verfestigen, und das in großer Menge und mittels ausgefeilter Werkzeuge, sind eher eine Gefahr als eine Hilfe. Daniel Bell sprach in seinem Klassiker Die postindustrielle Gesellschaft von den sog. Intellektuellen Technologien.
Unübertroffen sind daher noch immer die Worte Peter F. Druckers:
Der Computer hat dieselbe Wirkung auf strategische Entscheidungen. Er kann sie natürlich nicht treffen. Alles, was er kann – selbst das ist mehr eine Möglichkeit als eine Tatsache – ist durchzuarbeiten, welche Schlussfolgerungen sich aus gewissen Prognosen in Bezug auf eine ungewisse Zukunft ergeben, oder umgekehrt, welche Prognosen gewissen vorgeschlagenen Aktionsprogrammen zugrunde liegen. Alles, was er tun kann, ist wieder rechnen. Aus diesem Grund braucht er klare Analysen, besonders über die Grenzbedingungen, die die Entscheidung zu erfüllen hat. Und dazu ist ein hochwertige Urteil erforderlich, bei dem man Risiken übernehmen muss.
Oder wie Theodore Levitt es ausdrückte:
What is needed is discrimination in the supply and use of data, not their sheer abundance, regardless of relevance. Discrimination cannot be experienced in a vacuum. Magnitudes must be limited to what is relevant and comfortably usable. The effective use of information is governed by the prinicple of parsimony: limit it to the more-or-less precise purpose at hand. A good thing is not necessarily improved by its multiplication. The governing question is: what is the question to be answered, the problem to be illuminated, the matter to be explored, the issue to be defined? And it is precisely because these are not self-defining concepts that it is essential to think them trough in advance, because not amount of data will tell you what information you´ll need to get at the right questions.
Aber nicht nur für Unternehmen ist es wichtig, sich mit der Frage der Quantität und Qualität der Informationen auseinanderzusetzen. Jeder von uns sollte sich im Zeitalter des Internets mit dieser Frage beschäftigen, wie es schon vor vierzig Jahren Alvin Toffler in seinem Buch Der Zukunftsschock empfohlen hat, heute unter dem Schlagwort Information Literacy bekannt:
Die >neue< Bildung muss den Menschen lehren, Informationen zu klassifizieren und umzuklassifizieren, ihren Wahrheitsgehalt festzustellen, wenn nötig Kategorien zu ändern, vom Konkreten zum Abstrakten überzugehen und umgekehrt, Probleme aus einer neuen Blickrichtung zu sehen – sich selbst etwas zu lehren. Der Analphabet von morgen wird nicht der Mensch sein, der nicht lesen kann, sondern derjenige, der nicht das Lernen gelernt hat.