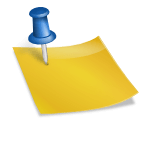Von Ralf Keuper
Einführung in die Wissenschaftstheorie von Elisabeth Ströker zählt für mich zum Besten, was zu diesem Thema in deutscher Sprache bisher veröffentlicht wurde. Auf gerade mal 135 Seiten schafft sie es, die Grundzüge der Wissenschaftstheorie herauszuarbeiten, ohne sich dabei auf eine bestimmte Position festzulegen, was wiederum nicht als Opportunismus zu werten ist. Erst zum Schluss lässt Ströker erkennen, welcher Richtung sie den Vorzug gibt.
Ströker ist stark von der Phänomenologie Edmund Husserls beeinflusst, was nicht verwundert, stand sie doch als Direktorin dem Husserl-Archiv der Universität Köln vor. Dennoch handelt es sich hier nicht um einen phänomenologischen Aufguss Husserlscher Prägung.
In der Einleitung schreibt Ströker über ihr Verständnis von Wissenschaftstheorie:
Es mag auf den ersten Blick naheliegen, als zuverlässigste Quellen für ihre Informationen die methologischen Äußerungen der Wissenschaftler anzusehen. Indessen hat die Wissenschaftsgeschichte in mehr als einem Falle gezeigt, dass solche Quellen, wo sie nicht überhaupt nur spärlich fließen und bald wieder versiegen, allzu leicht ein nur trübes und nicht selten sogar verfälschtes Bild der Wissenschaft geben. Sicheres und erfolgreiches Fortschreiten in der Wissenschaft hat sich nicht allein mit einem gänzlichen Mangel an Reflexion auf ihre Methoden von seiten der Wissenschaftler, sondern sogar auch mit deren gänzlich inadäquater Beschreibung als durchaus vereinbar erwiesen. Der Wissenschaftstheoretiker wird also keinesfalls nur aus Gründen unzureichenden Umfangs und mangelnder Genauigkeit wissenschaftlicher Selbstmitteilung auf diese allein nicht hören dürfen. Es kann ihm nicht erspart bleiben, dem Wissenschaftler auch bei seiner Arbeit selbst zuzuschauen – weniger darauf achtend, was dieser über sein Tun sagt, als vielmehr darauf, wie es tatsächlich beschaffen ist. Zu ihm aber gehört eine auslösende Fragestellung, die nicht allein aus einem größeren Problemzusammenhang heraus zu begreifen ist, sondern deren Sinnverständnis auch die Kenntnis bereits erworbener, jedoch in der Regel nicht mehr explizit formulierter, weil längst selbstverständlich gewordener Problemlösungen voraussetzt. Deshalb wird für den Wissenschaftstheoretiker ein gewisses Maß an spezifischer wissenschaftlicher Fachkompetenz unerlässlich, will er sich nicht dem berechtigten Vorwurf wissenschaftlichen Räsonnierens aussetzen. …
Methoden, so gründlich sie auch als solche analysiert zu werden verlangen, sind gleichwohl nichts für sich selbst, sondern sind Mittel zur Behandlung bestimmter Sachfragen. Die „Sache“ aber, um die es geht, ist nicht nur gebietsmäßig in den verschiedenen Wissenschaften und Wissenschaftsgruppen jeweils als solche eine andere; sie enthält auch in der Art ihrer wissenschaftlichen Befragung Rückverweisungen auf das fragende Subjekt. Weit davon entfernt, ihm einfach vorgegeben zu sein, als sei sie vor aller Problemfassung schon da und als nähme das Subjekt nur gleichsam nachträglich eine gegen sie selbst gleichgültige Beziehung auf, um zu erkennen, wie sie „an sich“ beschaffen ist, erweist sich bei näherem Hinsehen vielmehr die Sache selbst als durchaus abhängig von der Art der Fragestellung und ihrer wissenschaftlichen Behandlung. Diese hinwiederum richtet sich, obzwar auf die Sache, so doch nicht allein nach ihr, sondern rückt in sie in einen Horizont des Interesses. Die Bildung von Interessenperspektiven, die Festlegung von Sichtweisen für eine bestimmte Gegenständlichkeit mit ihren prinzipiellen Möglichkeiten der Ergänzung und Abwandlung ist aber ein Vorgang, in dem die Wissenschaftler nicht bloß passive Zuschauer eines von ihnen unabhängig sich abspielenden Geschehens sind, sondern bei dem sie sich äußerst aktiv verhalten.
Insbesondere die letzten Sätze zeigen eine enge Verwandschaft der Wissenschaftstheorie Strökers mit der von Ludwik Fleck.
Für gelungen halte ich auch die Kritik Strökers an Poppers Falsifikationsprinzip. Zwar lehnt sie Poppers Kritischen Rationalismus nicht gänzlich ab, macht aber auf einige grundlegende Defizite aufmerksam.
Warum sie das Falsifikationsprinzip in der Auslegung Poppers für zu streng und in gewisser Weise sogar für fortschritts- und wissenschaftsfeindlich hält, erläutert Ströker wie folgt:
Man muss, um das zu sehen, nicht einmal darauf hinweisen, dass im wissenschaftlichen Alltag eine Vielzahl von Verfahren praktiziert werden, die nichts von einem Bemühen um Falsifizierung und nicht einmal von kritischer Prüfung zeigen, ja es nicht einmal als sinnvoll erscheinen lassen. So enthält etwa die Wissenschaft allenthalben Problemgebiete, deren Theoretisierung noch gar nicht weit genug fortgeschritten ist, um hier bereits an kritische Prüfungen denken zu lassen, ohne dass man ihre Bearbeitung deswegen als unwisenschaftlich, ihre Ergebnisse als nicht gültig würde verwerfen können. Auch scheint Popper als selbstverständlich vorauszusetzen, dass die Wissenschaft einen in jeder ihrer Entwicklungsphasen und in allen ihren Gegenstandsbereichen völlig eindeutigen und logisch klaren Zusammenhang von Sätzen bildet, dessen Systematik grundsätzlich durchschaubar ist, dessen Verästelungen und Verknüpfungen jedenfalls nach strengen, methologisch einsichtigen und stets rationaler Kritik standhaltenden Prinzipien herstellbar wie auch eventuell auflösbar sind und die speziell auf eine Ordnung verweisen, welche sich bestenfalls in einem geschlossenen System finden ließe. Dass die Wissenschaft eine solche Systematik anstrebt und sie an einzelnen Stellen auch erreicht hat, ist so wenig bestreitbar, wie es unzweifelhaft eine wissenschaftstheoretische Fiktion ist, zu meinen es spiegele ein „fertiges“ Satzsystem auch den langwierigen Forschungsprozess wider, in dem er gewonnen wurde.
Irgendwie gewinnt man mit Blick auf die Debatte um das Für und Wider der Wissenschaftskommunikation den Eindruck, dass sich der Diskurs über die Bedeutung der Wissenschaftstheorie seitdem, das Buch erschien 1973, kaum weiter entwickelt hat.
Ironischer- bzw. tragischerweise war Elisabeth Ströker selbst Hauptfigur in einem der ersten Plagiatsfälle, über den die Medien damals (1990 und später) berichteten. Dabei ging es um ihre Dissertation aus dem Jahr 1953.
Das sollte hier nicht unerwähnt bleiben.
Fast zeitgleich hat Björn Haferkamp auf seinem Blog das Buch Wissenschaftstheorie zur Einführung von Martin Carrier vorgestellt.