Von Ralf Keuper
Das Dilemma komplexer Entscheidungssituationen, wie sie in Wirtschaft und Politik inzwischen eher die Regel als die Ausnahme sind, ist Thema von Luhmanns Aufsatz Zur Komplexität von Entscheidungssituationen.
So schreibt er:
Eine Entscheidungssituation wird komplexer, wenn die Zahl der Alternativen zunimmt; sie wird auch komplexer, wenn die Verschiedenartigkeit der Alternativen zunimmt oder wenn die Interdependenzen unter ihnen zunehmen, so dass man sie nicht mehr stückweise abarbeiten kann.
Eine an sich nicht sonderlich aufregende Erkenntnis, nur wird sie beim Homo Oeconicus nicht genügend berücksichtigt. Dort nämlich ist die implizite Annahme, dass der Entscheidungsträger sich der Verschiedenartigkeit und der Abhängigkeiten der Alternativen bewusst ist, sie also überblicken kann – ein Ding der Unmöglichkeit.
Daher ist es auch nicht allzu verwunderlich, wenn Luhmann dem herkömmlichen Begriff der Rationalität kritisch gegenübersteht:
Rationalität ist demnach nicht einfach durch das »erste Prinzip praktischer Vernunft«, die Gutheit bzw. den Wert des Zwecks, garantiert. Sie liegt auch nicht in der einfachen Relation von Zweck und Mittel. Sie besteht weder allein in der Maximierung der besonderen Wertrichtung des Zwecks (z.B. in der maximalen Ausbeutung von Ressourcen, größtmöglicher Ernte usw.) noch in der Optimierung der Relation von Mittel und Zweck (oder Aufwand und Ertrag). Für eine abstrakter ansetzende Entscheidungstheorie, die vom allgemeineren Begriff der Entscheidungsbeschränkungen (constraints) ausgeht, wird es zweitrangig, welche Beschränkungen als Zwecke und welche als Mittel fungieren, obwohl der Unterschied seine Funktion behält (hierzu Simon 1964). Zugleich wird der Begriff der Rationalität aus der Relation von Zweck und Mittel in die Relation zwischen möglichen Relationen zwischen Zweck und Mittel verlagert. Jene erste Relation wird nochmals relationiert, und dafür müssen jetzt Kriterien angegeben werden. Dieser Relationierung von Zweck/Mittel-Relationen hatte zunächst das Prinzip der Optimierung gedient. Es blieb jedoch gebunden an die Vorgabe von Beschränkungen in der Form von Zwecken und Mitteln und konnte nicht die Beschränkungen selbst als variabel postulieren. Das geschieht mit Hilfe der Begriffe Kontingenz und Komplexität. Andererseits geht es nicht an, nun die Kontingenz selbst oder gar Beliebigkeit für rational zu erklären.19 Sie ist nur eine Bedingung für Rationalität und verdient den Titel der Rationalität nur, sofern sie genutzt wird, um Entscheidungsbeschränkungen in den Entscheidungsprozessen einzuführen.
Das ist nun – wie bei Luhmann nicht anders zu erwarten – sehr abstrakt formuliert. Sofern ich ihn richtig verstanden habe, bemängelt er an den üblichen Entscheidungstheorien deren Verengung auf eine bestimmte Zweck-Mittel-Relation, ohne weitere in Betracht zu ziehen und sich die Beschränkungen, die zu einer bestimmten Zweck-Mittel-Relation geführt haben, bewusst zu machen. Damit geraten weitere Alternativen aus dem Blickfeld, d.h. die blinden Flecken bleiben unerkannt – die Komplexität und die situative Bedingtheit fallen unter den Tisch.
Häufig entscheidet ein Individuum, wenn es mit diesem Dilemma konfrontiert wird, impulsiv, d.h. ohne weitere Überlegung.
Eine adäquate Entscheidungstheorie hat daher bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen:
Sie muss sagen können, unter welchen Bedingungen rationales Entscheiden möglich bzw. wahrscheinlich ist; und das ist leichter, wenn man sich überlegt, unter welchen Umständen eine (vorauszusetzende, weil vorteilhafte) Tendenz zur Rationalität abgebrochen und in impulsives Entscheiden umgebogen wird. Sieht man Rationalität als Nutzenmaximierung, ist es schwierig, darauf eine Antwort zu geben; denn warum sollte ein Entscheider auf die Verfolgung seiner Werte verzichten? Genau hier liegen aber die empirischen Schwierigkeiten jeder Entscheidungstheorie, die von Nutzenmaximierung, Nachteilsminimierung oder sonstigen Richtigkeitskonzepten ausgeht; sie scheitert in dem Maße, als impulsives Entscheiden häufig ist.
Damit erneuert Luhmann seine Kritik an dem stets nutzenmaximierenden Entscheidungsträger, dem Homo Oecnomicus.
Um mit Entscheidungssituationen erhöhter Komplexität besser umgehen zu können, sollten dem Entscheider entsprechende Techniken zur Verfügung gestellt werden:
Von solchen Techniken wird es dann abhängen, ob ein Entscheider sich Situationsdefinitionen mit höherer Komplexität leisten kann und ob er deren Komplexität mehr auf der Dimension der bloßen Zahl von Alternativen oder auch in der Verschiedenartigkeit oder gar in Richtung auf höhere Interdependenzen steigern kann.
Eine weiteres Kalkül für den Entscheidungsträger könnte sein:
Kann man darüber entscheiden, ob man »Komplexität reduziert« oder lieber nicht reduziert, ob man sich Möglichkeiten offen hält oder ob man besser fährt, wenn man rechtzeitig so entscheidet, dass man nachher keine anderen Möglichkeiten mehr hat?
Hier bestehen Parallelen zu den Forschungen von Gerd Gigerenzer und den Fast and Frugal Heuristics.
Weiterhin interessant ist, wie Luhamnn die Rolle der Reflexivität während des Entscheidungsprozesses definiert, indem er den Begriff der Prozessreflexivität einführt:
Das alles setzt Reflexivität voraus, nämlich die Möglichkeit, den Entscheidungsprozess auf sich selbst zu beziehen. Die meisten Entscheidungstheorien setzen diese Möglichkeit als Bestandteil des Entscheidungsbewusstseins stillschweigend voraus, ohne sie zu problematisieren. Tatsächlich macht jedoch das bloße Entscheidungsbewusstsein als ein Wissen um Wahlfreiheit und Wahlvollzug einen Entscheidungsprozess noch nicht reflexiv. Bewusstsein des Entscheidens ist noch nicht Entscheiden über Entscheiden, so wenig wie Bewusstsein des Forschens Forschen über Forschung ist. Prozessreflexivität entsteht nur, wenn ein Prozess funktional spezifiziert und mit seinem eigenen Funktionstypus auf sich selbst angewandt wird. Das setzt doppelstufige Kontingenz voraus, indem das Entscheiden selbst nochmals als ganzes oder in seinen Prämis- sen oder in seinen Phasen zum Entscheidungsthema wird. Dezisionisten, die das Entscheiden bloß lieben oder bloß wollen, verfehlen diese anspruchsvolle Struktur der Reflexivität mitsamt den von ihr abhängigen Formen der Selektivitätsverstärkung.
Das grenzt schon an Hirnakrobatik und man beginnt zu verstehen warum es auch heisst: „Luhmann lesen ist wie Techno hören.“ 😉
Die Frage ist nur: Wie weit kann man die Abstraktion treiben, ohne die Orientierung zu verlieren?
Etwas klarer drückt er sich einige Zeilen später aus:
Nur bei hoher Komplexität der Entscheidungsmöglichkeiten wird das Entscheiden selbst zum Problem, weil dann die richtige Entscheidung nicht ohne weiteres sichtbar ist und zudem davon abhängt, wie die Komplexität reduziert wird. Dann drängt es sich auf, ganz oder zumindest partiell auch über das Entscheiden noch zu entscheiden, um dadurch den Entscheidungsprozess ohne Festlegung des Ergebnisses (das heißt: ohne ihn dadurch schon zu beenden) vorzustrukturieren.
Ähnlich wie Luhmann haben sich dazu auch Schoemaker und Russo geäußert.
Die eigentliche, spannende Frage lautet für Luhmann:
Eignet sich Komplexität theoretisch überhaupt zur Entscheidungsprognose? Ist, mit anderen Worten, zu erwarten, dass komplexere Entscheidungsprozesse tendenziell zu anderen Entscheidungen führen als weniger komplexe? Wird jemand, der einen komplexeren Berufswahlprozess durchläuft, systematisch in andere Berufe gelenkt als Bewerber mit einfacherer Orientierung? Kauft jemand, der komplexer entscheidet, andere Wagen? Und dies, weil er komplexer entscheidet? Oder braucht umgekehrt jemand, der sich einen Mercedes leisten kann, gar nicht mehr komplex zu entscheiden?
Damit wären wir wieder am Ausgangspunkt. Sind die Resultate komplexer Entscheidungsprozesse so viel besser, dass sie den Aufwand rechtfertigen, indem sie verborgene Zusammenhänge sichtbar machen und damit unnötige Risiken vermeiden helfen oder ungeahnte Chancen an die Oberfläche bringen? Oder dreht man sich damit häufig nur im Kreis, um dann zu derselben Entscheidung zu gelangen, die man nach kurzer Beratung oder aus dem Bauch heraus getroffen hätte?
Das hängt davon ab …

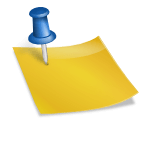




Das Interessante an Luhmanns entscheidungstheoretischen Überlegungen scheint mir zu sein, dass sie selbst eine Reflexion der Selbstreflexivwerdung der Moderne darstellen und damit dem gewählten Arbeitsprogramm gerecht werden. Dass nämlich alle Beschreibungen immer nur unter Voraussetzung anderer Beschreibungen möglich sind und dass jede Beschreibung auch sich selbst zu Gegestand haben und machen kann. Und eben diese Sichtweise kann auch in entscheidungstheoretischen Konzeptionen nicht ausßer Acht gelassen werden.
Zum Aspekt der Selbstreflexivwerdung der Moderne empfehle ich:
Helmut Wiesenthal: Rationalität und Unsicherheit in der Zweiten Moderne
http://www.afs-ev.de/div-pap/ratio_und_unsicherheit.pdf
Vielen Dank für den Kommentar. Vor allem der Hinweis, dass jede Beschreibung sich selbst zum Gegenstand haben und machen kann, erscheint mir wichtig. Eine Tatsache, die im Alltag immer wieder untergeht.
Besten Dank auch für den Lesetip. Der Autor war mir bis zur Lektüre von "Deutschland im Schavan-Test: In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?" auf Carta heute morgen noch nicht bekannt. http://carta.info/53568/deutschland-im-schavan-test-in-welcher-gesellschaft-leben-wir-eigentlich/
Der Hinweis auf den Wiesenthal-Artikel ist in diesem Zusammenhang übrigens sehr gut, weil er auf ein interessantes Entscheidungsproblem aufmerksam macht. Mit jeder Entscheidung, ob ein Doktortitel aberkannt wird oder nicht, vollzieht sich ein Erfahrungsbildungsprozess darüber, wie in weiteren Fällen zu entscheiden wäre. Nun ist es in diesen Plagiatsaffären so, dass eigentlich nicht jeder Fall anders beurteilt werden kann, weil sonst nicht klar wäre, wozu es Regeln gibt. Regeln sollen für eine Vielzahl unterschiedlicher Probleme realtiv allgemeine Leitlinien für eine Entscheidung liefern. Man sieht aber langsam, dass der Erfahrungsbildungsprozess immer aufdringlicher die Beobachtung in der Erscheinung treten lässt, dass beinahe jeder Fall verschieden behandelt werden muss. Das heißt entscheidungstheoretisch, dass Regeln selbst wiederum in Regeln eingeteilt werden müssen, dies allerings nach einem Schema, das durch diesen Prozess überhaupt erst entstehen kann.
Man erkennt: Unsicherheit ist notwendige Voraussetzung dafür, dass man noch entscheiden kann und will, weil Sicherheit strukturell gar nicht mehr zu erwarten ist.
An dem Fall Schavan, wie Wiesenthal ihn interpretiert, wird auch deutlich, wie Teilsysteme der Gesellschaft auf andere Einfluss zu nehmen versuchen, obwohl die Regeln jeweils andere sind bzw. sein sollten. Werden diese nun, wenn auch nur teilweise, außer Kraft gesetzt, kann dies nicht ohne Folgen für andere Bereiche sein. Es sei denn, die nötige Diskussion wird durch ein Basta! oder allgemeines Totschweigen abgewürgt oder aber in einen größeren Zusammenhang gestellt, nach dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. Die Rückkehr zur Tagesordnung wird heute jedoch immer schwieriger, da die digitale Öffentlichkeit die Themen auch dann vorantreibt oder wieder aufnimmt, wenn andere, vor allem auch die klassischen Medien, sie bereits vergessen haben bzw. vergessen wollen.
Das Thema Entscheidung unter Unsicherheit hat Luhmann am Beispiel der Banken einmal sehr aufschlussreich verdeutlicht:
"Im Operationsbereich der Banken wird das Wirtschaftsrisiko auf der Ebene der Beobachtung zweiter
Ordnung selbstreferentiell. Das heißt vor allem: dass es für Banken nur Risikokommunikation und keine Sicherheit gibt. Selbst ihr organisationseigenes Risikomanagement reicht nicht aus, um ihnen Sicherheit zu gewähren; es dient nur dem bestmöglichen Umgang mit Unsicherheit. Und ihr Geschäft mit Risiken ist folglich ein Geschäft der Transformation von Risiken in Risiken anderen Zuschnitts oder anderer Risikoträger, aber nicht ein Geschäft der Transformation von Risiko in Sicherheit. … " (in: Soziologie des Risikos)