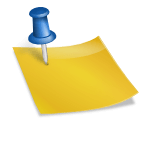Von Ralf Keuper
Für den Rechtshistoriker Peter Oestmann kommt das freie, selbständige Denken während des Studiums zu kurz; so auch der Titel seines Beitrags in der FAZ, der vergleichsweise hohe Wellen schlug. Den Studenten fehle, so Oestmann am Beispiel seiner eigenen Wissenschaftsdisziplin, häufig der kritische Blick von außen, die Beobachterperspektive. So gehe der Blick für das Ganze verloren. Die Mehrzahl der Studenten betrachte die Universität als reinen Ausbildungsbetrieb.
Wie lässt sich die zahlenmäßig kleine Gruppe derer ermitteln, die an der Sache interessiert sind? Wie kann die Neugier gestärkt werden und welche Änderungen im Prüfungswesen sowie in der Lehre sind dazu erforderlich? Geht das über eine Stärkung der Seminarkultur, über alternative Prüfungen, mehr Essays und Hausarbeiten? Er schreibt:
Wenn wir als Leitbild den gebildeten und kritischen Jurastudenten ausgeben würden, müssten wir dann genau solche Prüflinge nicht für ihre Offenheit und Neugierde belohnen, anstatt sie abzustrafen, wenn sie die sechste Mindermeinung zum Dolus eventualis nicht kennen? Die starke Fixierung auf Abschlussklausuren kommt in erster Linie dem Techniker und Rechtshandwerker zugute. Bildung im umfassenden Sinne zeigt sich im persönlichen Gespräch, bei eigener Forschung der Studenten, in glücklichen Fällen im Seminar. Aber die meisten Studenten besuchen nur ein Seminar, weil nur dieses eine Seminar vorgeschrieben ist. Und die meisten Professoren können sich nicht durchringen, ein zweites Pflichtseminar einzuführen. Haben sie selbst Angst vor der Entschulung? … Der Philosoph Hans-Georg Gadamer sagte einmal, eine Universität ohne Kunstgeschichte sei keine Universität. Vielleicht ist ein Jurastudent ohne minimale Allgemeinbildung an einer Hochschule auch falsch aufgehoben
Für Oestmann reicht der Besuch von Vorlesungen allein nicht aus, um sich das für einen Juristen nötige Wissen anzueignen. Studenten sollten vielmehr beginnen intensiv zu lesen, auch Lektüre, die nicht zum Lehrplan zählt, und herausfinden, was sie besonders interessiert, um das dann wiederum zu vertiefen.
Oestmanns Äußerungen blieben nicht ohne Widerspruch, wie in Hier geht es um Indianer, nicht um Häuptlinge. Darin stellt Hinnerk Wissmann fest:
Unsere Studierenden profitieren davon, dass ihre Leistungen nicht Tag für Tag in eine Endnote eingerechnet werden, sondern sie selbstverantwortlich mit ihrem Studium umgehen müssen. Gesegnet sei das Staatsexamen! Es sind auf dem Weg dorthin Klausuren, Hausarbeiten und Seminare zu absolvieren, aber nur als Zulassungsvoraussetzungen, die nicht mehr zählen, wenn das große Schlussexamen ansteht. Es ist an den Studenten, den Weg dahin zu planen – Sinnbild universitärer Freiheit in schönster Manier.
Sollte die Planung des Weges zum Abschlussexamen Ausdruck der Freiheit in ihrer höchsten Form sein, dann ist es, so jedenfalls mein Eindruck, um die Freiheit nicht allzu gut bestellt. Quasi nach dem Motto: Ihr habt die Freiheit, verpflichtet zu sein, oder wie? Diese Haltung lässt keine kritische Reflexion der Regeln und damit auch keinen Blick von außen zu. Schicksalsergebenheit als Ideal.
Weder die Wiederbelebung des Humboldtschen Universitäts-Verständnisses in reiner Ausprägung noch die Reduzierung der Freiheit als Fähigkeit, den vorgegebenen Weg zum Abschlussexamen nach eigenem Zeitplan zu absolvieren, scheint mir die Lösung zu sein.
Michael Wrase hält es in Juristische Bildung – Eine Münsteraner Debatte mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates aus dem Jahr 2012:
Ein grundsätzliches Festhalten am Staatsexamen bei gleichzeitiger Stärkung der Ausbildung in den sogenannten „Grundlagen“ der Rechtswissenschaft – mit der notwendigen Konsequenz einer (angemessenen) Reduktion des abzuprüfenden Pflichtstoffs in den dogmatischen Fächern.