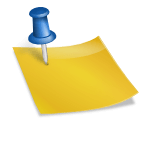In seinem Buch „Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik“ analysierte Kurt Sontheimer die geistigen Grundlagen des antidemokratischen Denkens in der Weimarer Republik und zeigte auf, wie eine bestimmte philosophische Strömung den Boden für totalitäre Bewegungen bereitete.
Hauptthesen des Textes
Die Irrationalismus-Kritik: Sontheimer identifiziert die Abkehr von der Vernunft als zentrale Gefahr. Die deutsche Geistesgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts sei geprägt gewesen von einer grundsätzlichen Verachtung rationaler Denkmethoden zugunsten von „Erleben“, „Fühlen“ und „mystischer Einswerdung“. Diese antirationale Haltung war zunächst harmlos, solange sie sich auf Geschichtsforschung und Mythologie beschränkte, wurde aber gefährlich, als sie auf Politik und Gesellschaft angewandt wurde.
Im politischen Denken der Weimarer Zeit wurde die Gefahr des Irrationalismus weithin nicht erkannt. Dass dies nicht geschah, liegt in der geistigen Strömung selbst begründet, aus welcher sich antidemokratisches Denken ableitet. Die Abwendung von der Ratio, die das Geistesleben des beginnenden 20. Jahrhunderts in Deutschland kennzeichnete, führte vielfach zur Verurteilung rationaler Denkmethoden schlechthin. Die Ausschließlichkeit, mit der man das Leben über den Geist stellte, war so lange ungefährlich, wie sich die neue Sicht auf die Erforschung der Vergangenheit und ihrer Mythen richtete. Im antidemokratischen Denken jedoch, das polemisch auf die unmittelbare Gegenwart bezogen war, musste die Anwendung irrationaler Verfahrensweisen auf Staat und Gesellschaft umso problematischer werden, da die moderne Daseinswelt zu ihrem Funktionieren gerade auf das Vorherrschen rationaler Strukturen in Wirtschaft und Verwaltung angewiesen ist.
Das Relativismus-Paradox: Der Versuch, den geistigen Relativismus des 19. Jahrhunderts durch neue absolute Weltanschauungen zu überwinden, führte paradoxerweise zu noch mehr Relativismus. Verschiedene konkurrierende Absolutheitsansprüche verstärkten die kulturelle Orientierungslosigkeit, anstatt sie zu beheben.
Die antidemokratische Alternative: Sontheimer beschreibt, wie sich ein „neuer Geist“ formierte, der das Geistige verachtete, Kampf und Krieg anbetete und das Bürgerlich-Zivile hasste. Ziel war die Zerstörung der bürgerlichen Ordnung zugunsten eines „völkisch geballten Machtstaates“.
Besonders bemerkenswerte Aspekte
Die Analyse des Nationalsozialismus als Massenphänomen: Sontheimer erklärt den Erfolg der NSDAP durch ihre ideologische Vieldeutigkeit. Gerade die „bruchstückhafte Zusammensetzung ideologischer Einzelteile“ ermöglichte es verschiedenen Wählergruppen, sich wiederzufinden – ein wichtiger Einblick in die Mechanismen populistischer Bewegungen.
Die Vieldeutigkeit der nationalsozialistischen Ideologie war eine allgemeine Bedingung für den großen Massenzulauf. Sie bot dem einzelnen Wähler die Möglichkeit, seinen eigenen ideologischen Standort im Nationalsozialismus wiederzufinden. In der bruchstückhaften Zusammensetzung ideologischer Einzelteile verriet sich der Massencharakter des Nationalsozialismus. Denn keine Partei, die zu einer Volkspartei großen Stils werden will, kann es sich leisten, ideologisch zu eindeutig festgelegt zu sein, da sie dadurch einen bestimmten Wählerkreis automatisch ausschließt.
Der pervertierte Demokratiebegriff: Besonders erhellend ist die Analyse, wie antidemokratische Kräfte den Demokratiebegriff für sich vereinnahmten. Sie propagierten eine „wahre Demokratie“ durch „Identität von Regierenden und Regierten“, eliminierten aber gleichzeitig alle demokratischen Rechte und Institutionen. Carl Schmitts Theorie wird als Beispiel dafür angeführt, wie auch Minderheiten als „Volk“ auftreten können, wenn sie nur entschlossen genug sind.
Der antiliberale Demokratiebegriff gründete auf der Idee der völkischen Einheit, im Gegensatz zum liberalen Demokratiegedanken, der in letzter Instanz auf das Individuum bezogen bleibt. Durch die Identität von Regierenden und Regierten (C. Schmitt) sollte das Volk als politische Größe wieder unmittelbar in Erscheinung treten. Die vermittelnden Instanzen, wie sie durch das repräsentative Prinzip in Parteien und Parlamenten verkörpert wurden, waren damit hinfällig geworden. Man brauchte sie nicht mehr. Volk bedeutete in diesem Zusammenhang jedoch nicht mehr die Zusammenfassung aller Volksangehörigen. Auch Carl Schmitt konnte eine zahlenmäßige Minderheit als Volk auftreten lassen und die öffentliche Meinung beherrschen, wenn sie nur gegenüber einer politisch willenlosen oder uninteressierten Mehrheit einen echten politischen Willen hatte.
Die strukturelle Analyse: Sontheimer zeigt auf, dass in modernen Industriegesellschaften autoritäre Staatskonzepte zwangsläufig in totalitäre Praxis münden müssen. Dies ist eine wichtige Warnung vor scheinbar „gemäßigten“ autoritären Positionen.
Wenn heute von konservativen Ideologen Wert darauf gelegt wird, sie seien nicht für den totalitären, sondern für den autoritären Staat eingetreten, so sollten sie sich klarmachen, dass unter den Bedingungen der industriellen Massengesellschaft mit ihren pluralistischen Kräften die autoritäre Staatsidee in eine totalitäre Praxis münden muss. In einem Zeitalter, welches die Demokratisierung der Massen erlebt hat, kann man nicht mehr hinter die Epoche der Demokratisierung zurückgehen, wenn man wirksame Politik machen will.
Aktualität und Relevanz
Der Text ist bemerkenswert aktuell in seiner Analyse populistischer und antidemokratischer Bewegungen. Die Mechanismen – ideologische Vieldeutigkeit, Vereinnahmung demokratischer Begriffe, Verachtung rationaler Diskurse zugunsten emotionaler Mobilisierung – lassen sich auch in heutigen politischen Entwicklungen wiederfinden.
Sontheimers Warnung vor der Unterschätzung irrationaler politischer Strömungen und seine Analyse der Gefahren, die von der grundsätzlichen Infragestellung rationaler Diskursmethoden ausgehen, bleiben hochrelevant für das Verständnis gegenwärtiger Herausforderungen der Demokratie.